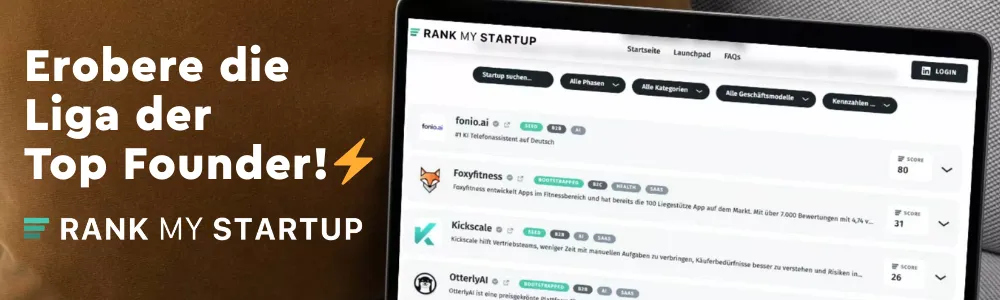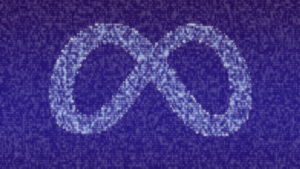Future{hacks}: How-to: Von Hype-Driven Development zu stabiler Lieferfähigkeit

Im Repo stapeln sich Sprachen und Frameworks. Jede Änderung braucht einen Übersetzer. Das ist keine Vielfalt, das ist kognitive Last. Und die wächst nicht, weil Projekte es verlangen – sondern weil zu viele Entscheidungen nach Trends und Tech-Influencern getroffen werden. Statt Stabilität und Pragmatismus regiert Hype-Driven Development. Das Ergebnis: mehr Komplexität, weniger Lieferung.
Worum es geht
Das eigentliche Problem ist nicht, dass mehrere Sprachen existieren. Natürlich gibt es gute Gründe für Python im Data-Umfeld oder Rust für Performance-kritische Systeme. Das Problem ist die Willkür. Teams wechseln zwischen Sprachen, Frameworks und Libraries, nicht weil es nötig ist, sondern weil es cool klingt oder weil „irgendwo auf GitHub“ jemand damit ein Problem gelöst hat, das im eigenen Projekt gar nicht existiert.
Wenn Projekte lieferfähig bleiben sollen, braucht es Disziplin: ein klarer Kernstack, wenige Ausnahmen und ein Fokus auf Verständnis statt Tool-Hopping. Wer Konzepte nicht versteht, aber mit Frameworks jongliert, produziert keine Resilienz, sondern Abhängigkeiten.
Was heute bremst
Projekte scheitern selten an der Wahl der Programmiersprache allein. Viel häufiger bremsen ungenaue Anforderungen. Stories, die ohne die richtigen Fragen entstehen, führen zwangsläufig in Lücken und Nacharbeit. Klassische Refinement-Meetings gibt es zwar, aber komplexe Aufgaben lassen sich selten von Analyst:innen oder Requirements Engineers alleine durchdenken. Hier braucht es Entwickler:innen, die Edge Cases früh erkennen und einbringen. Nur so entstehen Anforderungen, die tragfähig sind – nicht nur in der Theorie.
Dazu kommt ein zweiter Faktor: mangelndes Konzeptverständnis. Viele setzen auf Frameworks wie Spring oder Angular, ohne die dahinterliegenden Prinzipien wirklich zu verstehen. Das führt zu Copy-Paste-Engineering, unklaren Architekturen und zusätzlicher Wartungslast.
Die Lehre: Teams sind stärker als Rollen. Und Projekte brauchen mehr Beratung und Klarheit am Anfang, nicht nur Coding-Kapazität am Ende. Consulting schlägt Coding Monkey.
Ein moderner Kern
Der Weg raus ist kein dogmatischer Religionskrieg, sondern Pragmatismus. TypeScript ist heute die sinnvollste Primärsprache für 80 Prozent der Arbeit: Frontend, Backend, Automatisierung, Infrastruktur. Python ergänzt dort, wo Daten dominieren. Rust oder Go nur dann, wenn es um Performance oder Sicherheit wirklich nicht anders geht – und dann klar isoliert.
So entsteht nicht Einfalt, sondern Klarheit: ein gemeinsamer Nenner, schnellere Einarbeitung, weniger Übersetzung, weniger Komplexität.
Architektur als Hebel
Wer glaubt, ein kompletter Neubau löst die Probleme, verwechselt Stolz mit Strategie. Effektiver ist das Strangler-Pattern: Altsysteme schrittweise entkoppeln und neue Module daneben aufbauen. Eine klare Trennung zwischen Frontend und Backend, einheitliche Build- und Testpfade, ein Fehlerkanal statt fünf. Keine Helden-Frameworks, sondern sauberes Handwerk. Thoughtworks und Team Topologies weisen seit Jahren auf diesen Weg hin: weniger Ballast, mehr Fluss.
Wissen schlägt Tooling
Die Wahrheit ist: Sprachen und Frameworks sind Werkzeuge, keine Rettung. Wer die Konzepte dahinter nicht versteht, baut nur auf Sand. Dependency Injection, Architekturprinzipien, Testing – das sind die Grundlagen, die Resilienz schaffen. Libraries, Frameworks und AI können unterstützen, aber die Verantwortung liegt beim Entwickler.
Wenn wir als Branche relevant bleiben wollen, müssen wir uns nicht am nächsten GitHub-Hype messen, sondern an unserem Verständnis. Wer Konzepte meistert, kann jedes Framework einsetzen – statt von jedem Framework abhängig zu werden.
Full-Stack dort, wo Wirkung entsteht
Die Zukunft gehört Teams, die den gesamten Weg beherrschen – von der Oberfläche bis zur Auslieferung. Kein Ticket-Pingpong zwischen Spezialisten, keine Wissensabgabe an externe Dienstleister. Ja, das ist am Anfang teurer. Aber es spart in jeder Iteration. Für Österreich und die EU ist das entscheidend: Prozesswissen muss vor Ort bleiben, sonst bleiben wir in Abhängigkeit.
Woran man Erfolg erkennt
Erfolg misst sich nicht an der Zahl der Frameworks im Lebenslauf, sondern an Takt und Ergebnis. Wenn neue Kolleg:innen nach Wochen produktiv sind statt nach Monaten Bootcamp. Wenn Fehler sofort geschlossen werden, weil ein Team die ganze Strecke versteht. Wenn Releases planbar laufen und nicht jedes Mal ein Wochenendritual oder Gremien-Marathon auslösen.
Unser Future{hacks} Fazit
Digitale Souveränität entsteht nicht durch immer neue Tools, sondern durch Klarheit im Stack und Verständnis im Team. Eine Primärsprache, weniger Hype-Jagd, weniger kognitive Last, Verantwortung Ende-zu-Ende. Das stärkt die Wertschöpfung im Land und reduziert Abhängigkeiten von Dienstleistern, die morgen verschwunden sein können.
Markus Kirchmaier ist Prokurist & Partner bei LEAN-CODERS und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem IT-Arbeitsmarkt sowie modernen IT-Systemen und technologischen Entwicklungen. Hier geht es zu den anderen Beiträgen aus der Future{hacks}-Reihe.