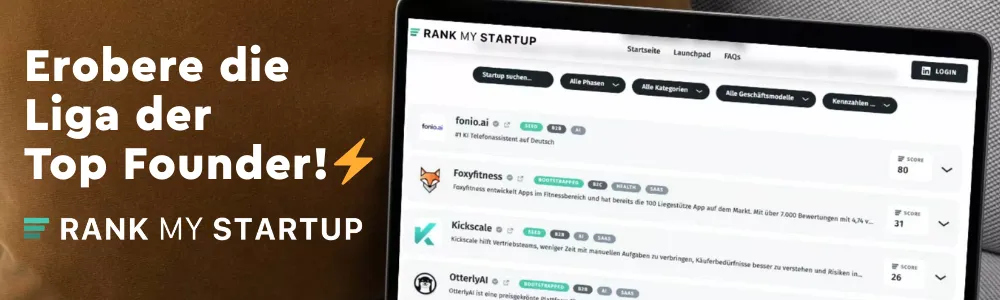Future{hacks}: Exit statt Lock-In: Die neuen Spielregeln im EU-Cloudmarkt

Die Schlagzeile klingt schlicht: Cloud wechseln wird leichter. Die Wirklichkeit ist spannender. Zum Start des EU Data Act drehen die großen Anbieter an ihren Konditionen und öffnen die Tür ein Stück weiter. Wir prüfen, was im Alltag trägt und wo die Arbeit beginnt.
Das kleine Einmaleins
Der EU Data Act ist ein neues EU Gesetz rund um Zugang zu Daten, deren Nutzung und Portabilität. Seit dem 12. September 2025 gelten Teile davon. Ein Kernpunkt ist der leichtere Wechsel zwischen Cloud Anbietern und weniger künstliche Hürden beim Mitnehmen von Daten. Die EU ergänzt das mit Musterklauseln, die fairere Verträge erleichtern. Praktisch heißt das weniger Lock in und mehr Spielraum beim Aufbau von mehr als einer Cloud.
Was sich in den letzten Tagen konkret geändert hat
Google führt ein Programm ein, bei dem für berechtigte Multicloud Workloads innerhalb derselben Organisation die Datentransfergebühren auf Seiten von Google in der EU und im Vereinigten Königreich entfallen. Ziel ist spürbar mehr Interoperabilität zwischen Anbietern.
Microsoft rechnet in Europa seit August Transfers zum Selbstkostenpreis ab. Gemeint ist keine Pauschale, sondern eine Abrechnung nach realen Netz und Prozesskosten.
AWS bietet reduzierte Sätze in bestimmten Anwendungsfällen. Kundinnen und Kunden müssen den Fall begründen und aktiv beantragen.
Drei Missverständnisse, drei Klarstellungen
- Kostenlos heißt nicht grenzenlos. Gratis gilt bei Google nur für einen klar definierten Anwendungsfall und nur auf der Google Seite. Zielseitige Gebühren oder Verarbeitungskosten können weiter anfallen.
- Zum Selbstkostenpreis ist nicht für umsonst. Der Ansatz von Microsoft orientiert sich an realen Kosten. Das ist fairer als Pauschalen, bleibt aber ein Preis.
- Auf Antrag ist nicht automatisch. Bei AWS hängt die Ermäßigung vom Einzelfall ab. Wer sie will, muss sie begründen und aktiv beantragen.
Wo der Nutzen sofort ankommt
Dort, wo Multicloud bereits gelebt wird. Also wenn Analyse in Anbieter A läuft, Ausspielen in Anbieter B passiert und Daten zwischen beiden Diensten fließen. Dort, wo Datenlokalität zählt, zum Beispiel in Finanz und Gesundheitsbereichen. Oder wo niedrige Latenz wichtig ist, etwa bei Medien oder Industrie nahe an Nutzenden und Maschinen. Die neuen Regeln und Preismodelle machen solche Architekturen planbarer.
Was bleibt anspruchsvoll
Formate und Schnittstellen
Wer Daten mitnehmen will, braucht saubere Exporte in offenen Formaten und gut dokumentierte Programmierschnittstellen. In der Praxis scheitert es oft an Kleinigkeiten. Ein Feld heißt plötzlich anders, ein Datentyp weicht ab, ein Zeitstempel hat eine andere Zeitzone. Proprietäre Funktionen sind schwer zu übersetzen, zum Beispiel besondere Indizes, Trigger oder Abfrageerweiterungen in Datenbanken.
Planbar wird der Wechsel, wenn es für jede Datenklasse einen definierten Export gibt, inklusive Beispieldatensatz, Prüfsumme und Rückimporttest. Dazu gehört auch ein Plan für den Neuaufbau von Suchindizes, also den Datenstrukturen für schnelle Suche, sowie von Vektordatenbanken für semantische Suche und von Caches, damit nach dem Umzug nicht tagelang die Antwortzeiten leiden.
Identitäten und Berechtigungen
Nach dem Wechsel müssen Zugriffe wieder genauso präzise funktionieren wie davor. Das betrifft Menschen, Dienste, Schlüssel und Freigaben. Unterschiedliche Begriffe für Rollen und Gruppen, abweichende Standardrechte oder andere Gültigkeitsdauern für Zugangstokens führen schnell zu Lücken.
Hilfreich ist eine Landkarte der Berechtigungen mit klaren Entsprechungen bei Quelle und Ziel. Dazu zählen auch Maschinenkonten, Dienstnutzer, Geheimnisse für Anwendungen und der Ablauf für Schlüsselwechsel. Erst wenn Prüfprotokolle auf beiden Seiten zeigen, dass die gleichen Personen und Dienste nur das dürfen, was sie sollen, ist der Schritt wirklich getan.
Beobachtbarkeit
Protokolle, Messwerte und Ablaufspuren sollten nach dem Wechsel lückenlos sein, sonst fliegen Fehler unter dem Radar. Unterschiedliche Formatierungen von Protokollen, andere Aufbewahrungsfristen oder fehlende Kennungen zur Verknüpfung von Ereignissen sorgen dafür, dass ein Problem in System A nicht mit dem Ereignis in System B verbunden wird.
Vor dem Umstieg lohnt sich ein kleiner Probelauf. Ein echter Datenfluss über beide Plattformen, dazu einige Testalarme, ein geplanter Ausfall, und danach der Nachweis, dass jede Meldung ankommt, die richtige Person erreicht und in der gleichen Form in den Berichten landet.
Nachweisführung
Regulatorik will Spuren sehen. Wer wechselt, dokumentiert, welche Daten wohin gingen, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen. Dazu gehören Protokolle der Exporte, Prüfsummen der Datenpakete, die Freigabe durch die Verantwortlichen und die Bestätigung, dass im Ziel die gleichen Schutzmaßnahmen wirken.
Wer in regulierten Branchen arbeitet oder Kundendaten bewegt, sollte zusätzlich eine kurze Lagebeschreibung erstellen, die Zweck, Rechtsgrundlage und technische Schutzmaßnahmen in Klartext erklärt. Das spart Rückfragen bei Prüfungen und schafft Vertrauen bei Kunden.
Netzwerk und Zeitfenster
Große Datenmengen brauchen Durchsatz, kleine Zeitfenster für riskante Änderungen brauchen Disziplin. Online Transfer ist bequem, aber oft langsam und teuer. Manchmal ist ein physischer Export auf Datenträgern schneller und sicherer, verlangt aber genaue Planung und lückenlose Dokumentation.
Wichtig sind klare Wartungsfenster, eine Phase ohne Nebenbaustellen und ein Plan für den Fall, dass das Zeitfenster nicht reicht. Parallelbetrieb für kritische Dienste kann die Nerven schonen, kostet aber vorübergehend doppelt. Am Ende zählt, dass es einen getesteten Rückweg gibt. Wer in einer Übung den Schritt zurück geprobt hat, schläft in der Wechselwoche deutlich besser.
So wird aus Gesetz Wirkung im Betrieb
Startet mit einer Inventur der Datenwege. Welche Flüsse sind regelmäßig, welche einmalig, welche zeitkritisch. Legt ein kleines, aber realistisches Probeszenario fest, mit einem echten Datenauszug, identischen Tests vor und nach dem Transfer, einem kurzen Parallelbetrieb und einem schriftlichen Protokoll der Abweichungen.
Vereinheitlicht Schnittstellen und Artefakte, also offene Spezifikationen, exportierbare Konfigurationen und Infrastruktur als Code. Übt den Rückweg. Wer hin wechseln kann, sollte auch zurück wechseln können. Das klingt trocken, schafft aber Souveränität im besten Sinn.
Ein Wort zur Freiheit von der Wolke
Der Data Act schafft die Bühne, nicht die Musik. Er nimmt Hürden und gibt ein Werkzeug in die Hand. Ob daraus Tempo entsteht, entscheiden Architekturen und Verträge. Wo offene Standards und portable Bausteine zum Einsatz kommen, sinken Wechselkosten strukturell. Ein kleiner Anteil Rechenarbeit am Rand des Netzes, also näher an Gerät oder Werk, reduziert zudem dauerhaft Ausleitungen in fremde Clouds.
Ergänzend passt hier Gaia X als europäische Initiative für vertrauenswürdige Datenräume. Gemeint sind gemeinsame Regeln, eine Referenzarchitektur und Dienste für Föderation, die Identitäten, Kataloge und Richtlinien anbieterübergreifend zusammenbringen. In der Praxis hilft das, Daten nicht nur zu verschieben, sondern sie über Unternehmensgrenzen hinweg kontrolliert zu teilen. Zusammen mit dem Data Act entsteht so ein Rahmen, der Wechselkosten senkt und Zusammenarbeit in Europa erleichtert. Das alles wirkt auf Kosten, Datenschutz und Verhandlungsmacht.
Unser Future{hacks} Fazit
Der EU Data Act ist kein Zauberstab, aber ein Katalysator. Wechseln wird messbar, Portabilität verhandelbar. Es lohnt sich, den Wechsel ins Auge zu fassen und den eigenen Zuschnitt sauber durchzuspielen. Danach entscheidet man mit Ruhe und auf Basis von Zahlen.
Markus Kirchmaier ist Prokurist & Partner bei LEAN-CODERS und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem IT-Arbeitsmarkt sowie modernen IT-Systemen und technologischen Entwicklungen.