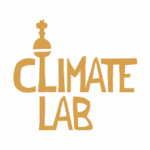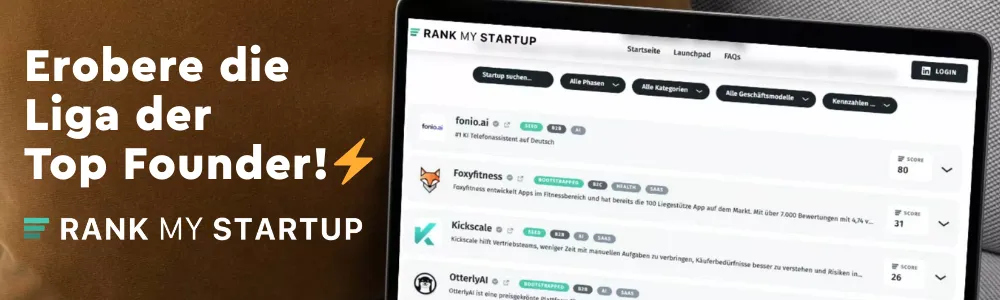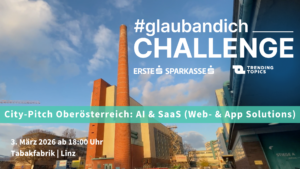Circular und Green Jobs: Lokale Wertschöpfung mit sozialem Touch

In unserem Community Talk hat Impact Redakteurin Jacqueline Riecker mit Marion Schulz gesprochen. Marion ist Projektmanagerin des Climate Lab und hat im vergangenen Jahr das Projekt „Kreislaufwirtschafts Jobs“ in Partnerschaft mit waff und arbeit plus betreut, in dessen Rahmen ein Konzept für sogenannte „Circular und Green Jobs“ erarbeitet wurde.
Liebe Marion, das Projekt mit dem waff zu Kreislaufwirtschaftsjobs wurde ja 2024 umgesetzt. Du hast es für das Climate Lab verantwortet. Was genau kann man sich unter dem Projekt vorstellen?
Marion Schulz: Das Projekt war der Auftakt unserer Partnerschaft mit dem waff – gestartet sind wir im Februar 2024. Im ersten Schritt haben wir eine grundlegende Analyse durchgeführt. Dabei haben wir verschiedene Studien und Definitionen zu Circular und Green Jobs gesichtet. Ein wesentlicher Teil war aber auch der Austausch mit unterschiedlichen Stakeholdern – zum Beispiel mit sozialökonomischen Betrieben und Vertreter:innen der Privatwirtschaft.
Auch arbeitsmarktpolitische Akteure waren wichtige Gesprächspartner, weil sie große Expertise in diesem Bereich mitbringen. Besonders interessant war der Kontakt mit sozialökonomischen Betrieben, die seit Jahrzehnten in der Kreislaufwirtschaft tätig sind und als echte Pioniere gelten – etwa im Re-Use- und Reparaturbereich. Diese Betriebe verbinden Arbeitsmarktintegration mit konkreten Tätigkeitsfeldern, die ökologisch relevant, aber wirtschaftlich oft wenig lukrativ sind.
Wie zum Beispiel das Projekt magdas?
Magdas ist ein gutes Beispiel für einen sozioökonomischen Betrieb, auch wenn es nicht Teil unseres Projekts war – es wird von der Caritas getragen. Aber in die Richtung geht es, ja. Im Ergebnisbericht haben wir eine ganze Liste solcher Betriebe angeführt, mit vielen davon standen wir auch im direkten Austausch. Es ist wirklich eine sehr spannende Kombination: Auf der einen Seite geht es darum, Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, und auf der anderen Seite darum, Bereiche wie Re-Use und Reparatur zu stärken – also Tätigkeiten, die gesellschaftlich sinnvoll, aber nicht immer wirtschaftlich tragfähig sind.
Also ein ganzheitlicher Blick auf Produkte und ihren Lebenszyklus, mit dem Ziel, möglichst viel im Kreislauf zu halten?
Genau. Früher waren das vielleicht einfache Nähwerkstätten – heute ist das viel breiter aufgestellt. Besonders beeindruckt hat mich das DRZ im 14. Bezirk – das Demontage- und Recyclingzentrum. Dort waren wir auch vor Ort.
Was genau macht das DRZ?
Das DRZ übernimmt für die MA 48 die Wiederaufbereitung und das Recycling von Elektrogeräten innerhalb Wiens. Es ist ein sozialökonomisch organisierter Betrieb, der stark durch das AMS gefördert wird. Das Ziel ist die Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt – oft mit betreuter Ausbildung vor Ort. Das ganze System ist sehr strukturiert, aber auch kostenintensiv.
Wir haben uns das gemeinsam mit arbeit plus Wien, dem Dachverband dieser Betriebe, genauer angesehen. Dabei ging es vor allem darum, wie man Ausbildungskonzepte für den Bereich Kreislaufwirtschaft gestalten kann. Denn wir müssen heute schon überlegen, welche Kompetenzen in den nächsten Jahren gebraucht werden. Ausbildungen entstehen nicht über Nacht – da hängen viele Entscheidungsprozesse dran.
Das heißt, die Hauptzielgruppe waren Menschen, die aktuell schwer Zugang zum Arbeitsmarkt haben?
Genau. Das war die zentrale Zielgruppe des Projekts. Im Konzept haben wir das noch einmal differenziert: Einerseits junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, andererseits auch ältere Personen – teils mit Vorerfahrung, teils mit zusätzlichen Herausforderungen wie fehlenden Deutschkenntnissen. Insgesamt haben wir drei große Themenfelder identifiziert, auf die wir uns konzentriert haben: Elektronik, Textilien und Bau.
Warum genau diese drei Bereiche?
Wir haben schnell gesehen, dass in diesen Bereichen besonders viel Potenzial steckt – sowohl was den ökologischen Impact betrifft als auch in Bezug auf Arbeitsplätze. In allen drei Feldern wurden mögliche Ausbildungskonzepte auf einer Metaebene von arbeit plus Wien entwickelt. Dabei wurde auch deutlich, dass sich gerade viel verändert. Man kann nicht einfach ein Unternehmen fragen: „Was braucht ihr?“ – denn vieles ist aktuell im Umbruch. Es ist bekannt, dass sich durch neue Regulierungen – wie die Ökodesign-Verordnung oder das Recht auf Reparatur – vieles ändern wird. Aber vieles ist noch nicht final ausdefiniert, da gibt es noch viel Spielraum für Gestaltung.
Gibt es konkrete Zeitpläne für die Umsetzung dieser Regulierungen?
In manchen Bereichen, wie etwa bei Textilien, gibt es bereits Fahrpläne – allerdings sind viele Details noch in Arbeitsgruppen auf EU-Ebene in Ausarbeitung. Es gibt also schon Pläne, die auch im Konzept enthalten sind, aber sie sind noch nicht in Stein gemeißelt.
Ich habe gesehen, dass auch das AMS Österreich und IKEA in das Projekt eingebunden waren. Mit wem habt ihr sonst noch zusammengearbeitet?
Ja, das AMS ist ein sehr wichtiger Partner, weil es nicht nur Fördermittel verwaltet, sondern auch strategisch mitgestaltet. Sie entscheiden mit, wie Qualifizierungen aussehen und welche Betriebe gefördert werden. Auch IKEA war Teil des Netzwerks, speziell im Textilbereich gibt es da sicher Potenzial.
Besonders spannend war für mich der Elektronikbereich. Da hatte ich das Gefühl, dass es eine echte Aufbruchstimmung gibt. Unternehmen wie EP:Elektronikpartner haben viele Ideen, wie sich Re-Use dort weiterentwickeln lässt. Auch die AFB, die gebrauchte Elektronikgeräte in Österreich aufbereiten, waren sehr interessante Gesprächspartner, ebenso wir auch Refurbed. Uns war wichtig, Betriebe aus Österreich einzubinden, weil wir hier Arbeitsplätze schaffen wollen und lokale Wertschöpfung im Fokus steht.
Einige dieser Betriebe sind ja schon seit Jahrzehnten in dem Bereich aktiv?
Ja, absolut. Viele machen das schon sehr lange – zum Teil seit 30 Jahren. Jetzt rücken sie stärker in den Fokus, was ich sehr begrüßenswert finde.
Du hast eingangs das Re-Use im Baubereich angesprochen – was fasziniert dich daran besonders?
Mich begeistert die Idee, Baumaterialien wiederzuverwenden und gleichzeitig Weiterbildung anzubieten. Ein schönes Beispiel ist der Buurman Baumarkt in Rotterdam. Dort kann man nicht nur Re-Use-Materialien kaufen, sondern sich auch beraten lassen, wie man damit eigene Projekte umsetzen kann. Im Rahmen unseres Projekts haben wir im Baubereich eng mit Baukarussell zusammengearbeitet. Sie haben das Konzept „Social Urban Miner“ entwickelt. Dabei geht es um die Vorbereitung für den Rückbau, also etwa das fachgerechte Ausbauen von alten Türen, Fenstern usw., um sie wiederverwenden zu können. Der Zugang ist möglichst niederschwellig – ideal, um Menschen auf weitere Ausbildungen oder Beschäftigung vorzubereiten.
Wie geht es mit dem Projekt jetzt weiter?
Unser Anspruch ist es, nicht bei einem Bericht stehen zu bleiben. Wir wollen, dass sich daraus konkrete nächste Schritte entwickeln. Ein wichtiger Fokus ist die Bewusstseinsbildung – sowohl bei Entscheidungsträger:innen als auch in der breiten Öffentlichkeit. Wir stellen das Projekt gerade auf verschiedenen Ebenen vor. Das Climate Lab, der waff und arbeit plus arbeiten weiterhin intensiv an diesen Themen. Gerade im Textil- und Elektronikbereich gibt es schon erste Ideen für Pilotprojekte– auch was mögliche Fördermöglichkeiten betrifft.
Plant ihr auch eine Erfolgskontrolle oder Begleitmaßnahmen?
Ja, wir begleiten die Entwicklungen weiter und tracken, was daraus entsteht. Die Partnerschaft mit dem waff geht in diesem Jahr weiter – und wir arbeiten bereits am nächsten Projekt.
Darf man schon wissen, worum es im neuen Projekt geht?
Es bleibt beim Fokus auf Jobs in der Kreislaufwirtschaft, allerdings auf anderen Qualifizierungsniveaus. Wir arbeiten auch weiter intensiv mit arbeit plus zusammen – aus dieser Kooperation ist mittlerweile eine Ecosystem-Partnerschaft entstanden. Wir wollen die sozialökonomischen Betriebe auch in zukünftige Climate-Lab-Projekte aktiv einbinden.
Marion Schulz ist Teil des Programmteams des Climate Lab. Sie beschäftigt sich mit Innovationsprojekten im Bereich der Kreislaufwirtschaft – mit einem besonderen Fokus auf den Bausektor.
Das Climate Lab ist ein Innovationshub für Klima-Akteur:innen aus ganz Europa. Es handelt sich dabei um eine Initiative des österreichischen Klima- und Energiefonds und des Klimaschutzministeriums (BMK) und wird gemeinsam mit dem größten Energieversorger des Landes, der Wien Energie, dem EIT Climate-KIC und dem Impact Hub umgesetzt.