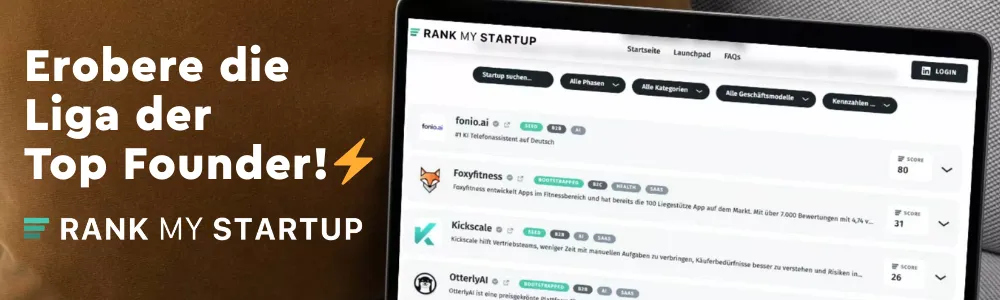E-Mopeds am Radweg: „Ein pauschales Verbot löst keine Probleme, es schafft neue“

Achraf Tlemsani ist Betreiber von rider.at, das E-Mopeds an Lieferando-Boten vermietet, und außerdem selbst Essenszusteller. In diesem Gastbeitrag diskutiert er die Folgen des geplanten Verbots von E-Mopeds auf Wiener Radwegen, die oft von Lieferboten gefahren werden. E-Mopeds sind laut Stadt Wien „zu schnell, zu schwer und zu gefährlich am Radweg“, deswegen sollen sie mit Änderungen der Straßenverkehrsordnung und des Kraftfahrgesetzes vom Radweg verbannt werden.
Ein neues Gesetz soll E-Mopeds von Radwegen verbannen. Begründet wird es mit einer Studie, die höhere Geschwindigkeiten und Gewichte anführt. Doch diese Argumente halten einer genaueren Prüfung nicht stand. Ich schreibe hier nicht als Lobbyist, sondern als Betroffener: Ich bin Essenszusteller und habe eine kleine Firma gegründet, die legale 25-km/h-Fahrzeuge verleiht. Für mich und viele andere geht es nicht um eine abstrakte Debatte, sondern um unsere tägliche Arbeit, unsere Sicherheit und unsere Zukunft.
Die TU-Wien-Studie stellte fest:
- 31 % der E-Mopeds fahren schneller als 25 km/h
- 15 % fahren über 29 km/h
- Gewicht: 70–80 kg
Doch diese Werte müssen kritisch betrachtet werden. Erstens: E-Bikes dürfen mit Toleranz bis 28 km/h fahren. Der Unterschied zu 29 km/h ist marginal, aber in der Studie wird daraus eine dramatische Gefahr konstruiert. Zweitens: Lastenräder transportieren Fahrer:in plus mehrere Kinder oder Güter und erreichen 150 kg oder mehr – sie sind also teils doppelt so schwer wie E-Mopeds, bleiben aber erlaubt.
Drittens: Belastbare Unfallstatistiken fehlen völlig. Es gibt keine seriöse Datenbasis, die zeigt, dass E-Mopeds auf Radwegen signifikant mehr Unfälle verursachen. Die Argumentation basiert stark auf „gefühlter Bedrohung“ statt auf harten Fakten. Viertens: Das Kernproblem ist die Infrastruktur. Radwege wurden historisch für Fahrräder gebaut. Heute haben wir Lastenräder, S-Pedelecs,
E-Mopeds – neue Fahrzeugtypen, die mehr Platz brauchen. Statt die Infrastruktur anzupassen, will man ein Verbot verhängen. Das ist Symbolpolitik.
Internationale Perspektive
Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass Österreich Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren:
- In den Niederlanden sind S-Pedelecs und schnelle E-Bikes Teil des Systems. Dort wird Infrastruktur ausgebaut, um verschiedene Geschwindigkeiten sicher zu trennen.
- In Deutschland gibt es ebenfalls Diskussionen, aber statt pauschaler Verbote setzt man auf differenzierte Regeln, etwa Sonderwege und Kennzeichnungspflichten.
- In Frankreich gilt ein strenger Rechtsrahmen, gleichzeitig wird massiv in Radwege und „Velostrassen“ investiert.
Überall erkennt man: Neue Mobilität braucht Raum und Regeln – aber keine simplen Verbote. Österreich könnte von diesen Erfahrungen lernen.
Politische Widersprüche: Von Förderung zu Elektroschrott
Noch vor kurzem hat der Staat E-Mopeds gefördert – als Beitrag zu klimafreundlicher Stadtlogistik. Viele Zusteller:innen und kleine Unternehmen haben investiert, weil das politische Signal lautete: „Das ist die Zukunft.“ Heute droht das Gegenteil: Die gleichen Fahrzeuge sollen verboten werden. Damit werden sie zu gefördertem Elektroschrott. Solche widersprüchlichen Signale zerstören Vertrauen in Förderpolitik und bremsen Innovation. Wer investiert künftig noch in nachhaltige Mobilität, wenn der Staat seine Meinung alle paar Jahre ändert?
Ein Rückschritt speziell für Migrant:innen und Geflüchtete
Die meisten Essenszusteller:innen in Wien sind Geflüchtete oder Migrant:innen. Für sie ist dieser Job oft der erste Schritt in den Arbeitsmarkt, eine Chance, Deutsch zu lernen, Kontakte zu knüpfen und ein eigenes Einkommen zu erzielen. Ein Verbot würde diesen Menschen den Zugang erschweren, ihre Integration verlangsamen und sie wieder stärker in Abhängigkeit von Sozialleistungen drängen. Für viele kleine Verleihfirmen – wie die meine – ist das Geschäftsmodell unmittelbar gefährdet.
Große Firmen könnten die Kosten für Versicherung und Bürokratie noch tragen, kleine nicht. Das bedeutet: mehr Arbeitslosigkeit, mehr Insolvenzen, weniger Chancen für jene, die eigentlich Teil der Lösung sein wollen. Warum aber unbedingt das E-Moped, wenn es doch auch andere Fahrzeuge gibt? Hier einige Gründe
- Zehn Stunden am Tag mit Fahrrad oder E-Bike zu arbeiten, ist schlicht nicht möglich. Nur komfortablere Fahrzeuge wie die heutigen E-roller machen den Job realistisch machbar.
- Diese Fahrzeuge bieten mehr Sicherheit und Wetterschutz, besonders im Winter.
- Viele Zusteller:innen besitzen keinen Führerschein (keine Zeit, kein Geld, Sprachbarrieren). Ein Umstieg auf Benzinroller ist für sie nicht möglich.
- Ein Verbot bedeutet für viele: Jobverlust, Arbeitslosigkeit und Sozialleistungen statt Teilhabe und Beitrag.
- Auch die wenigen, die mit E-Mopeds auf der Fahrbahn weitermachen würden, müssten neue Kosten tragen, etwa Versicherung, Anmeldung, Einzelgenehmigung. Für viele ist das nicht leistbar und/oder viel zu bürokratisch. Sie würden letztlich ebenfalls aufgeben.
Gerade für Geflüchtete ist dieser Job oft der erste Einstieg in die Arbeitswelt. Solche Gesetze erschweren Integration, statt sie zu erleichtern.
Wirtschaftliche Folgen
Ein pauschales Verbot schwächt den Wettbewerb. Kleine Unternehmen verschwinden, große Player dominieren den Markt.
Das ist nicht nur unfair, es bremst auch Innovation. Startups bringen oft kreative Ideen in den Markt – vom Sharing-System bis zur nachhaltigen Logistiklösung.
Doch wenn das regulatorische Umfeld unberechenbar wird, investieren Gründer:innen nicht mehr. Österreich braucht aber gerade diese Innovationskraft, wenn es international mithalten will. Zudem führt ein Verbot zu längeren Lieferzeiten. Zusteller:innen auf der Straße brauchen länger, stehen öfter im Stau. Kund:innen werden unzufriedener, Restaurants verlieren Umsatz. Die Folgen reichen also weit über die Zustellerbranche hinaus.
Warum ein Verbot ein Rückschritt zu Autos und Benzinrollern wäre
E-Mopeds sind sauber und leise. Wenn man sie von Radwegen verbannt, werden viele auf Autos oder Benzinroller umsteigen.
Die Folgen: mehr CO₂, mehr Feinstaub, mehr Lärm. Nachzustellungen in Wohngebieten werden für Anwohner:innen unangenehmer.
Die Klimaziele, die Österreich erreichen will, werden so in weite Ferne gerückt. E-Mopeds sind eigentlich ein Teil der Lösung –
die Politik macht sie zum Problem. Das ist ein ökologischer Rückschritt.
Das wichtigste Verkaufsargument (und fast das Einzige) für Essenszusteller:innen ist: „Du darfst damit auf dem Radweg fahren.“
Mit E-Rollern oder Fahrrädern auf der Straße zu fahren, ist deutlich gefährlicher und für viele schlicht nicht zumutbar. Autos übersehen kleine Fahrzeuge leicht, dazu kommt der enorme Geschwindigkeitsunterschied. Genau aus diesem Grund gibt es Radwege.
Wenn die Nutzung der Radwege entfällt, bleiben für viele nur zwei Optionen:
- Umstieg auf Autos oder Benzinroller → mehr CO₂, mehr Lärm, mehr Stau – genau das Gegenteil dessen, was Politik eigentlich erreichen will. Also ein klarer Rückschritt
- Aufgabe des Jobs → mehr Arbeitslosigkeit und weniger Integration. Also ein klarer Rückschritt
Außerdem: Sollte künftig auch noch ein TÜV vorgeschrieben werden, müssten viele Fahrzeuge verschrottet werden, tonnenweise Elektroschrott, obwohl sie zuvor staatlich gefördert wurden. Auch das wäre ein klarer Rückschritt.
Konkrete Alternativen
Es gibt Lösungen, die Sicherheit erhöhen, ohne Klimaziele, Arbeitsplätze und Integration zu gefährden:
- Mehr Geschwindigkeitskontrollen auf Radwegen, statt pauschaler Verbote.
- Kooperation mit Plattformen wie Foodora, Lieferando oder Uber Eats, um verpflichtende Schulungen für Zusteller:innen einzuführen.
- Technische Standards: Abriegelung bei 25 km/h, Gewichtslimits, verpflichtende Brems- und Lichtausstattung.
- Infrastruktur anpassen: Kurzfristig breitere Radwege, langfristig eigene „Light Vehicle Lanes“ für neue Fahrzeugtypen.
- Erst eine belastbare Datenbasis schaffen, bevor man Gesetze beschließt. Symbolpolitik hilft niemandem.
Vision für die Zukunft
Statt E-Mopeds zu verbieten, sollten wir überlegen, wie Wien in zehn Jahren aussehen kann. Stellen wir uns eine Stadt vor, in der breite Radwege verschiedene Geschwindigkeiten sicher trennen, in der „Light Vehicle Lanes“ Lastenrädern, E-Mopeds und S-Pedelecs Platz geben. Eine Stadt, in der leise, saubere Fahrzeuge den Verkehr entlasten und die Luftqualität verbessern.
Eine Stadt, in der Integration gelingt, weil Jobs im Liefersektor Menschen eine Perspektive geben. Diese Vision ist erreichbar – aber nicht durch Verbote, sondern durch Investitionen, Mut und Dialog.
Ein pauschales Verbot löst keine Probleme – es schafft neue. Sicherheit, Klimaziele, Arbeitsplätze und Integration dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Politik sollte Mobilität fördern, die sich anpasst und weiterentwickelt. Wir Zusteller:innen sind bereit, Teil der Lösung zu sein. Was wir brauchen, ist Dialog, keine Symbolpolitik.