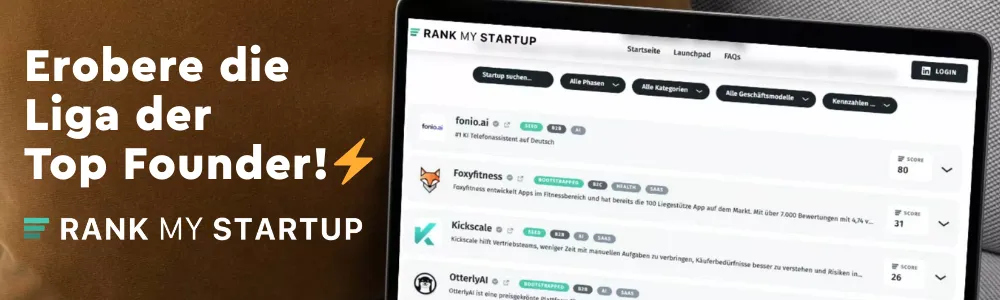Der neue EU-Name-Check: Effiziente Betrugsprävention oder Bürokratiemonster?

Kseniia Kutyreva ist Managing Director Financial Crime & Risk Management bei Finom. In diesem Gastbeitrag beschäftigt sie sich mit der EU-Verordnung zu IBAN-Name-Checks.
Ab dem 9. Oktober tritt in der EU die sogenannte „Verification of Payee“-Regelung (VoP) in Kraft. Künftig müssen Banken bei jeder Überweisung prüfen, ob der Name des Empfängers mit der angegebenen IBAN übereinstimmt. Ziel ist es, Fehlüberweisungen und Betrugsfälle einzudämmen – ein wichtiger Schritt für die Sicherheit im Zahlungsverkehr. Doch mit der neuen Sicherheitsebene kommen auch neue Hürden, auf die sich Verbraucher und Unternehmen einstellen müssen.
Mehr Schutz, weniger Fehlüberweisungen
VoP wird viele alltägliche Probleme beim Online-Banking entschärfen. Falsch eingegebene Kontonummern oder simple Betrugsversuche, bei denen Kriminelle durch gefälschte Rechnungen Geld auf eigene Konten umlenken, sollen deutlich seltener vorkommen. Für kleine und mittlere Unternehmen kann das ein echter Vorteil sein. Sie sparen Zeit, Aufwand und Geld, weil versehentliche oder betrügerische Überweisungen leichter erkannt werden.
Langfristig kann VoP so Vertrauen in den digitalen Zahlungsverkehr stärken. In Ländern wie den Niederlanden, wo ähnliche Systeme bereits im Einsatz sind, sind Betrugsfälle nach der Einführung deutlich zurückgegangen.
Mehr Sicherheit, mehr Hürden
In der Praxis wird VoP aber nicht nur klare Treffer liefern. Schon kleine Abweichungen, etwa durch Umlaute, Bindestriche, Doppelnamen oder unterschiedliche Schreibweisen von Firmennamen, können dazu führen, dass legitime Zahlungen als „No Match“ gewertet werden. Unternehmen müssen damit rechnen, dass Zahlungen verzögert werden, Supportanfragen zunehmen und interne Abläufe ins Stocken geraten.
Zudem kann ein falsches Sicherheitsgefühl entstehen: Eine „grüne Übereinstimmung“ bedeutet nicht automatisch, dass eine Zahlung sicher ist. Betrüger könnten künftig gezielt Konten unter ähnlichen Namen eröffnen oder bestehende Firmenbezeichnungen imitieren, um die Prüfung zu umgehen.
Was Unternehmen jetzt tun sollten
Für Betriebe bedeutet VoP vor allem eines: Sie müssen ihre Prozesse im Zahlungsverkehr prüfen und anpassen. Dazu gehört:
- Saubere Stammdatenpflege: Unternehmensnamen sollten in Zahlungsdateien immer einheitlich und korrekt erfasst sein.
- Überprüfung von Zahlungsläufen: Besonders bei Sammel- oder Lieferantenzahlungen lohnt sich eine VoP-Vorabprüfung, um Fehlermeldungen zu vermeiden.
- Sensibilisierung der Mitarbeitenden: Mitarbeitende im Zahlungsverkehr sollten wissen, wie sie auf Warnmeldungen reagieren und wann sie Zahlungen stoppen sollten.
- Kommunikation mit Partnern: Firmen sollten Lieferanten und Kunden frühzeitig über mögliche Verzögerungen informieren – gerade in der Einführungsphase.
Ein wichtiger Schritt, aber kein Allheilmittel
VoP ist ein Fortschritt im Kampf gegen Zahlungsbetrug. Es wird den Zahlungsverkehr sicherer und transparenter machen, aber nicht fehlerfrei. Unternehmen, die ihre Datenqualität und Prozesse frühzeitig anpassen, profitieren am meisten.
Wer sich jedoch ausschließlich auf VoP verlässt, riskiert neue Probleme: Fehlalarme, operative Verzögerungen und die Illusion vollständiger Sicherheit. Betrugsprävention bleibt ein Zusammenspiel aus Technik, Prozessen und Aufmerksamkeit. VoP ist dabei ein starker, aber nur einer von mehreren Bausteinen.