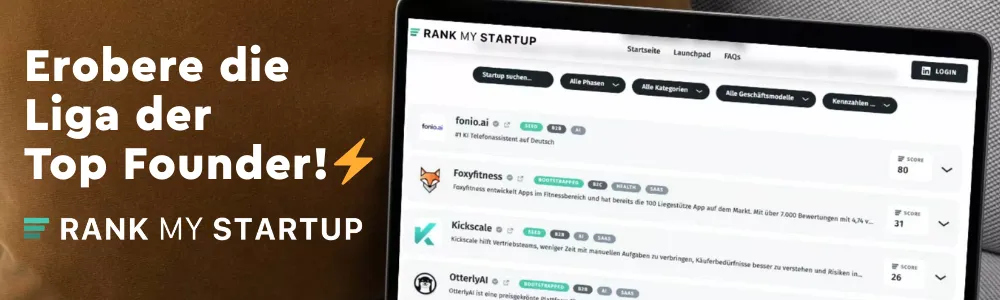Future{hacks}: CHECKOUT WIN – LOCK-IN FAIL: Smarte E-Commerce Entscheidungen treffen

Europa wächst im Onlinehandel weiter, Kund:innen kaufen auf vielen Kanälen, Budgets bleiben knapp. Gleichzeitig verschieben Plattformen, Gebührenmodelle und Regulierung laufend die Spielregeln. Die Rechnung ist einfach: Tempo ist wichtig, aber Abhängigkeiten kosten später. Wer heute E-Commerce plant, braucht beides – schnelles Go-live und eine echte Wechsel-Option. Die gute Nachricht: Das geht.
Der Markt: Wachstum mit Gegenwind
Der europäische Onlinehandel legte 2024 um sieben Prozent zu, für 2025 rechnen Verbände mit weiteren sieben Prozent Wachstum. Das klingt nach Rückenwind, bringt aber drei Realitäten mit sich, die Entscheidungen heute prägen:
Marktplatzdruck:
Temu sorgt mit aggressiver Preislogik für Schlagzeilen, die Debatte über faire Regeln kocht hoch. Europäische Marken kontern am besten mit eigenen Kanälen, klarer Differenzierung und Service, nicht nur mit Rabatt. Wer auf Preis allein setzt, verliert gegen chinesische Struktur-Arbitrage.
Regulatorik trifft Alltag:
Der EU Data Act gilt seit 12. September 2025 in weiten Teilen. Er stärkt Datenzugang und Wechselbarkeit, was modulare Architekturen attraktiver macht als reine Komplett-Suiten. Wer heute monolithisch baut, ignoriert geltendes Recht.
Werbung wird erwachsener:
Google hat die Abschaffung von Drittanbieter-Cookies in Chrome begraben. Das beruhigt kurzfristig, ändert aber nichts am Trend zu First-Party-Daten und direkter Kundenbeziehung. Wer Daten nicht selbst besitzt, bleibt abhängig.
Warum alle über Shopify reden und was das für Euch heißt
Shopify ist populär, weil man schnell starten kann. Ökosystem, Vorlagen, Services, ein optimierter Checkout. Interne und externe Studien verweisen seit Jahren auf starke Konversionswerte. Oft wird ein Plus von bis zu 36 Prozent gegenüber Wettbewerbern und bis zu 50 Prozent für Shop Pay gegenüber dem Gast-Checkout genannt. Das ist relevant, weil Konversion bares Geld ist.
Die Gegenrechnung gehört aber dazu. Gebühren und Bedingungen ändern sich. 2025 hat Shopify zum Beispiel die Entwickler-Revenue-Share neu justiert und bei neuen Shops zusätzliche Drittanbieter-Transaktionsgebühren rund um Store-Credit und Gift Cards eingeführt. Wer kalkulieren will, sollte das früh auf dem Zettel haben. Headless-Wege wie Hydrogen und Hosting via Oxygen gibt es zwar, sie bleiben aber plattformgebunden. Wer maximale Freiheit will, braucht mehr als eine schicke Frontend-Schicht. Das Frontend zu entkoppeln ist ein Schritt, aber wenn Backend, Checkout und Datenmodell weiterhin in fremder Hand liegen, bleibt die Abhängigkeit bestehen.
Takeaway:
Für Standardfälle ist die Suite schnell und performant. Für besondere Logik, harte Kostentransparenz und echte Wechsel-Pfade braucht es bewusste Architekturentscheidungen.
Der Gegenentwurf: Composable Commerce ohne Heiligenschein
Composable heißt: CMS, Suche, Checkout und Commerce-Engine sind eigenständige Bausteine, die sauber miteinander sprechen. Man startet dort, wo der größte Nutzen liegt, und tauscht Stück für Stück. Das senkt Abhängigkeiten und erhöht Verhandlungsmacht. Aufwand verschwindet nicht, er wird planbar.
David Höck, CEO von Vendure, bringt es auf den Punkt: „Eine moderne E-Commerce-Plattform muss heute vor allem eines sein: ein flexibles Ökosystem, kein starres System. API-First-Architektur, echte Headless-Fähigkeiten und die nahtlose Integration in bestehende Enterprise-Landschaften sind Grundvoraussetzungen. Die Plattform muss sich dem Geschäftsmodell anpassen – nicht umgekehrt.“
Prominente europäische Beispiele
Vendure als offene Commerce-Engine aus Österreich (!!!) auf TypeScript/Node mit klaren APIs und Plugin-Modell. Stark, wenn B2B-Logik, Marktplatzmodelle oder individuelle Workflows gebraucht werden. Code-Ownership und Erweiterbarkeit sind die Vorteile, Betriebsdisziplin ist die Gegenleistung. Wer bereit ist, selbst zu hosten oder mit spezialisierten Partnern zu arbeiten, gewinnt volle Kontrolle über Daten und Geschäftslogik.
Strapi als offenes Headless CMS aus Frankreich. Inhalte bleiben in der eigenen Hand, Self-Hosting ist möglich, die Cloud ist optional. Teams behalten die Kontrolle über Content-Modelle und Freigaben. Der Vorteil: Redaktionelle Workflows gehören Ihnen, nicht dem Plattformanbieter.
Warum das zur EU passt
Der Data Act fordert Wechselbarkeit und faire Datenverträge. Wer Module besitzt, Daten sauber exportiert und Wechselwege dokumentiert, lebt das nicht nur auf Folien, sondern im Betrieb. Composable Commerce ist nicht nur eine technische Entscheidung, es ist strategische Vorsorge für regulatorische Realität.
Entscheiden ohne Ratlosigkeit: Drei Fragen, die zählen
1. Tempo gegen Besonderheiten
Reicht Standard-Checkout und Katalog? Suite erwägen. Gibt es besondere B2B-Regeln, Multi-Vendor-Logik, individuelle Preismodelle? Composable prüfen.
Die meisten Shops brauchen keine Exoten-Features. Aber wenn Ihr Geschäftsmodell nicht in vorgefertigte Workflows passt, wird jede Suite zum Kompromiss und Kompromisse kosten entweder Funktionalität oder Geld für teure Anpassungen.
2. Datenhoheit und Wechsel-Option
Komme ich aus der Plattform sauber heraus? Gibt es klare Exporte, dokumentierte Schnittstellen, vertretbare Kündigungsfristen? Wie schwer ist es, Kundendaten, Bestellhistorie und Produktkataloge in ein anderes System zu überführen? Testet das nicht erst, wenn Ihr wechseln wollen. Fordert einen Testexport an, bevor Ihr unterschreibt. Wenn der Anbieter sich windet, wisst Ihr Bescheid.
3. Total Cost of Ownership
Nicht nur Planpreise betrachten. App-Gebühren, Transaktionsaufschläge, Entwickler-Provisionen, Integrationskosten und interne Aufwände ehrlich addieren. Ein Shop, der monatlich 99 Euro kostet, kann nach zwei Jahren teurer sein als eine gehostete Open-Source-Lösung mit initialen Entwicklungskosten. Die Rechnung hängt vom Volumen ab. Diese sollte gemacht werden, bevor man unterschreibt.
Sanft starten statt Big Bang: Ein realistischer Pfad
Ihr müsst nicht alles auf einmal umstellen. Ein schrittweiser Ansatz reduziert Risiko und liefert frühe Erfolge:
Schritt 1: Content entkoppeln.
Headless CMS vorziehen, Inhalte über API bereitstellen. Erste spürbare Wirkung, wenig Risiko. Redaktionelle Workflows verbessern sich sofort, der Shop läuft weiter wie bisher.
Schritt 2: Suche und PIM modularisieren.
Relevanz, Geschwindigkeit und Datenpflege verbessern, ohne den Shop zu zerlegen. Schlechte Suche kostet Umsatz, hier zahlt sich Investition schnell aus.
Schritt 3: Commerce-Pilot.
Bevorzugt ein headless und Open-Source – System (wie z.B. Vendure) in einer Kategorie oder Region testen. Checkout-Variante gegentesten, Datenflüsse protokollieren. Wenn es funktioniert, ausrollen. Wenn nicht, habt Ihr nur einen Teilbereich riskiert.
Schritt 4: Verträge und Daten sichern.
Export, Backups, Schlüsselverwaltung festzurren. Data-Act-Pflichten im Blick behalten. Dokumentiert, wer welche Daten wo speichert und wie Ihr im Ernstfall migriert.
Unser Future{hacks} Fazit
Suite ist Tempo. Composable ist Kontrolle. Wirklich stark wird, wer beides kann: schnell live gehen, aber die Architektur so bauen, dass Wechsel keine Horrorstory wird. Europas Händlerinnen und Händler brauchen genau das: weniger Abhängigkeiten, mehr eigene Bausteine, klar definierte Wechsel-Pfade.
Während andere in Gebührenmodelle gefangen sind, die sich jährlich ändern, könnt Ihr neu verhandeln, Module austauschen und auf veränderte Marktbedingungen reagieren. So entsteht Lieferfähigkeit, die auch in Jahren noch trägt.
Markus Kirchmaier ist Prokurist & Partner bei LEAN-CODERS und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem IT-Arbeitsmarkt sowie modernen IT-Systemen und technologischen Entwicklungen. Hier geht es zu den anderen Beiträgen aus der Future{hacks}-Reihe.