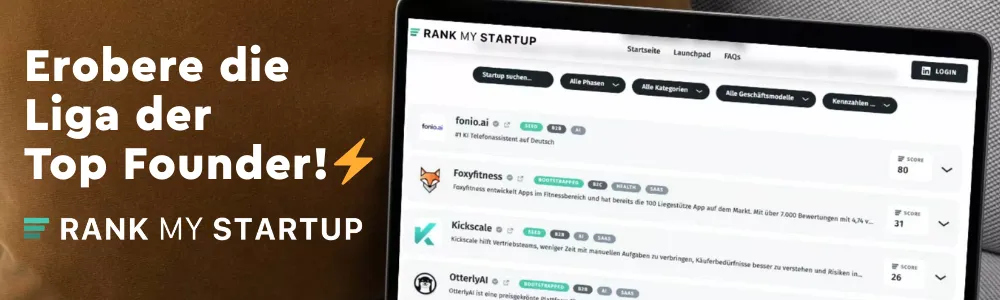Future{hacks}: Update oder Untergang: Warum Hardware-first die Sackgasse ist
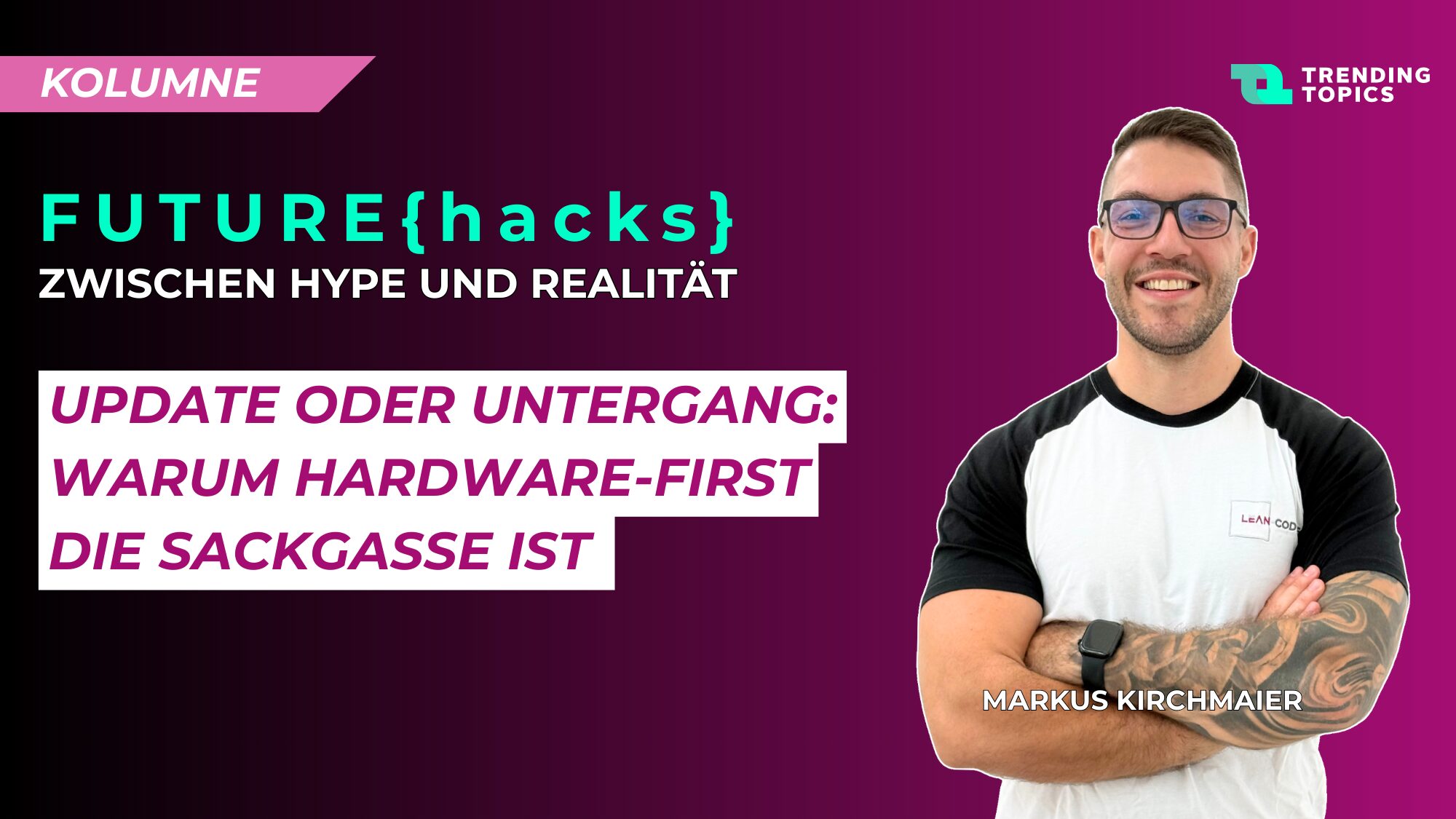
Wien liebt es, sich als „Smart City“ zu inszenieren. Klingt modern, glänzt in Broschüren, beruhigt Politik und Verwaltung. Aber schaut man genauer hin, sieht es weniger nach Zukunft aus und mehr nach Warteschlange im Bezirksamt. Die Wärmepumpe beim Kunden wartet auf den Servicetechniker, weil aus der Ferne nichts geht. Das Ladehub könnte Lastspitzen glätten, nur fehlt der benötigte Updatekanal.
Und der Spitalsaufzug hat längst die Softwareverbesserung, aber die liegt im Regal statt im Betrieb. Das sind keine Einzelfälle. Das ist das Ergebnis einer Kultur, die Hardware wie König behandelt und Software wie Beiwerk. Österreich und ganz Europa, haben den Startschuss in die digitale Wertschöpfung verschlafen. Während die USA und China längst mit Updates im Wochentakt arbeiten, diskutieren wir hier noch über Piloten.
Software ist Wertschöpfung
Wert entsteht nicht mehr beim Schraubenschlüssel, sondern beim Software-Update. Wer Software-first denkt, verlängert die Lebensdauer von Geräten, senkt Servicekosten und bringt neue Funktionen ins Feld, ohne neue Hardware einzubauen. Man gewinnt Zeit, Geld und Kundenzufriedenheit. Wer es nicht tut, verliert. Und zwar international.
Europa als Zuschauer
Die Beweise liegen auf dem Tisch, und sie tun weh. Europäische Unternehmen setzen Big Data und Künstliche Intelligenz messbar seltener ein als ihre US-Konkurrenten, der Rückstand beträgt sechs Prozentpunkte, wie die European Investment Bank festhält. Deutschland, einst Vorzeigeland der Industrie, wurde von China bei der Roboterdichte überholt. Während dort 470 Roboter auf 10.000 Beschäftigte kommen, sind es in Deutschland nur 429, berichtet die International Federation of Robotics. Und wenn man auf die zukünftigen Basistechnologien schaut, wirkt es noch düsterer: 2024 kamen 40 relevante KI-Modelle aus den USA, 15 aus China und ganze DREI aus Europa. Europa ist nicht mehr Mitbewerber, wir sind Zuschauer.
Österreich – Digital erstickt im eigenen System
Österreich selbst ist das Paradebeispiel dafür, wie man Digitalisierung erstickt. Updates sind im Beschaffungsprozess schlicht kein Thema. Gekauft wird nach Stückpreis und Funktionsliste. Niemand fragt nach Updatefähigkeit, nach Telemetrie oder einem sicheren Rückweg. So bleiben Prototypen eben nur Prototypen. Und selbst wenn ein Team weiß, was zu tun wäre, fressen Altlasten jede Iteration auf. Jede kleine Änderung braucht ein Gremium, ein Wochenendfenster, ein endloses Protokoll.
Aus Innovationsrhythmus wird Stillstand. Parallel dazu wandert Wissen ab, weil Outsourcing kurzfristig Geld spart, aber langfristig Lernkurven und Prozesswissen kostet. Das Ergebnis ist bitter: Nur 20 Prozent der heimischen Unternehmen beschäftigen überhaupt IKT-Fachkräfte. Das ist gerade mal Durchschnitt, kein Vorsprung.
Software-first in der Praxis
Dabei ist es so einfach. Software-first bedeutet, dass eine Wärmepumpe nicht nur heizt, sondern durch Updates effizienter wird. Ein Ladehub steuert Lasten dynamisch und rechnet sauber ab. Aufzüge, Zutrittssysteme und Lüftungen lassen sich aus der Ferne optimieren, ohne dass ein Techniker mit Schraubenschlüssel im Keller stehen muss. Und in der Industrie prüfen CNC-Maschinen, Sensoren und Fördertechnik die Qualität längst digital – wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Das Muster ist immer dasselbe: Telemetrie rein, Release raus, Freigaben und Rückweg stehen.
Tesla zeigt, wie es geht
Das Paradebeispiel liefert Tesla, egal was man von Elon Musk als Person halten möge. Die Marke glänzt nicht wegen Chromleisten, sondern wegen Software. Funktionen und Leistungs-Upgrades kommen over the air, ohne Werkstatt. Der Acceleration Boost wird per App freigeschaltet und sorgt für spürbar mehr Leistung. Das Auto wird nach dem Kauf wertvoller, nicht älter. Das ist Software-first in Reinform. Beratungen wie McKinsey zeigen glasklar, dass Over-the-Air-Updates Entwicklungszyklen verkürzen, zusätzlichen Umsatz generieren und das Update-Tempo erhöhen. Das ist keine Religion, das ist Betriebswirtschaft.
Führung muss liefern, nicht reden
Die Zeit für Ausreden ist vorbei. Führungskräfte müssen sich drei einfache Fragen stellen: Kommt Software regelmäßig bei euren Kundinnen und Kunden an? Habt ihr einen sicheren Updatekanal mit Freigaben, Telemetrie und getestetem Rückweg? Und könnt ihr in Wochen am echten Gerät testen oder hängt ihr immer noch an Roadmap-Runden, die ein Jahr später vielleicht mal in der Praxis landen? Österreichs Unternehmen setzen zwar zunehmend auf KI, aber in der Produktion liegt der Einsatz gerade einmal bei 15 Prozent. Diese von Statistik Österreich erhobene Zahl zeigt, wie groß der Aufholbedarf ist.
Souveränität oder Abhängigkeit
Software-first ist nicht nur ein technisches Thema, es ist eine Frage von Souveränität. Wer Software kontrolliert, kontrolliert die Wertschöpfung. Wer nur Hardware liefert, verliert. Digitale Souveränität bedeutet offene Schnittstellen, portable Datenformate, Full-Stack-Teams im Land und Updatefähigkeit als Standard. Wer liefert, gewinnt Verhandlungsmacht. Wer hier auf Altbewährtes setzt, verliert Zeit. Und während wir hier debattieren, sagt der italienische Wirtschaftswissenschaftler Mario Draghi glasklar, dass Europa bei Wachstum und KI-Skalierung zurückfällt. Wer heute keine digitalen Takte aufbaut, wird morgen über Rettungspakete diskutieren.
Future{hacks} meint
In zwölf Monaten zählt nur eine Frage: Sind eure Produkte nachweislich effizienter, sicherer oder einfacher geworden, weil Software-Updates regelmäßig ankommen? Wenn ja, dann habt ihr verstanden, was Software-first heißt. Wenn nein, dann war 2025 kein Geschäftsjahr, sondern ein weiteres Präsentationsjahr.
Markus Kirchmaier ist Prokurist & Partner bei LEAN-CODERS und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem IT-Arbeitsmarkt sowie modernen IT-Systemen und technologischen Entwicklungen. Hier geht es zu den anderen Beiträgen aus der Future{hacks}-Reihe.