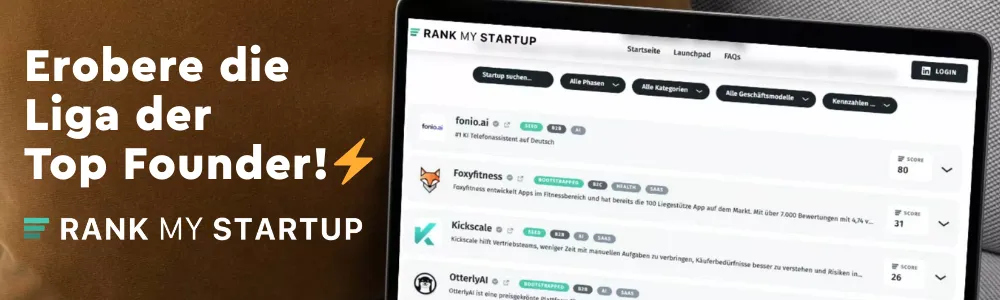KI – Blase oder eine der produktivsten Goldrauschphasen der Geschichte?

Gunnar Miller ist Senior Advisor bei TEQ Capital, einer Investmentboutique aus Bonn, die sich auf Technology Equity spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde vom Team hinter dem Risikokapitalgeber Freigeist Capital unter der Leitung von Technologie-Investor Frank Thelen gegründet. In diesem Beitrag beschäftigt sich Gunnar Miller mit den aktuellen Entwicklungen in der AI-Branche und den Ängsten vor einer AI-Blase.
„Ist KI eine Blase?“ war in den letzten Wochen eine häufig gesuchte Frage auf Google. Und sie ist durchaus berechtigt! KI kann sich etwa als Blase oder als Durchbruch erweisen. So oder so erleben wir, wie Billionen an Kapital mobilisiert werden und eine jahrzehntelange Transformation eingeleitet wird. Wir erleben wohl eine der produktivsten Goldrauschphasen der Geschichte.
Starke Fundamente, ambitionierte Bewertungen
Frühere technologische Blasen, wie die der Dotcoms, waren von Unternehmen ohne tragfähige Geschäftsmodelle geprägt. Heute ist die Lage anders. Die Fundamentaldaten der ‚Magnificent Seven‘ sind stark: Sie sind gut kapitalisiert, hochprofitabel und in vielen Segmenten quasi monopolartig positioniert. Während die „Nifty Fifty“ der 1970er Jahre auf KGVs von 45 –50 gehandelt wurden, liegt das KGV der heutigen Tech-Giganten bei rund 33.
Allerdings muss diese Bewertung im Kontext gesehen werden: Mit einem Shiller-KGV bei 40 befindet sich der S&P 500 auf einem Niveau, das mit den Höchstständen der Dotcom-Ära vergleichbar ist. Das unterstreicht das allgemeine Marktrisiko. Finanz- und Tech-Blasen unterscheiden sich; kennzeichnend für Tech-Blasen ist die Tendenz zur Überinvestition und zu daraus resultierenden Überkapazitäten.
Ein Apollo-Programm alle zehn Monate
Der Ausbau der KI-Rechenleistung hat eine Phase extremer Kapitalintensität eingeläutet. Allein dieses Jahr werden Tech-Unternehmen voraussichtlich 400 Mrd. US-Dollar in neue KI-Infrastruktur investieren. Zum Vergleich: Das gesamte Apollo-Mondprogramm kostete inflationsbereinigt rund 300 Mrd. US-Dollar. Der KI-Ausbau erfordert also alle zehn Monate ein neues Apollo-Programm. Um diese Investitionen ökonomisch zu tragen, sind laut Bain & Company jährlich zusätzliche Umsätze von rund zwei Billionen US-Dollar nötig.
Ein entscheidender Unterschied zur Telekommunikationsblase liegt in der kurzen ökonomischen Nutzungsdauer der Assets: Heutige KI-Chips sind in wenigen Jahren veraltet. Dennoch ist der Höhepunkt nicht erreicht: Die Investitionsausgaben im Verhältnis zum BIP liegen mit ca. 1 % weit unter den 4 %, die während des Eisenbahn-Booms erreicht wurden. Viele große KI-Konzerne haben ihre Bilanzen zudem noch nicht umfassend eingesetzt und die Kreditmärkte bislang kaum angezapft.
Vorsicht vor „ChatGDP“: Die Illusion der Dynamik
Besondere Vorsicht erfordert ein Phänomen, das man als „ChatGDP“ bezeichnen könnte: zirkuläre Geschäfte, die eine sich selbst verstärkende Illusion von Dynamik an den Märkten schaffen. So hat OpenAI Investitionen und Partnerschaften im Wert von über 800 Mrd. US-Dollar angekündigt, während gleichzeitig Partner untereinander investieren. Ein Teil dieser finanziellen Choreografie wird für einige Akteure schmerzhaft enden. Investoren werden sich anstrengen müssen, hier Verluste zu vermeiden – allerdings erst, nachdem Billionen durch das System geflossen sind.
Ausblick für Anleger: Nicht fürchten, sondern finanzieren
Die Zukunft der KI wird gerade jetzt gebaut. Diese massive Investitionswelle stützt auch die Gesamtwirtschaft, indem Einkommen in Sektoren wie Bau, Recht und Finanzen in den Konsum fließen. Die Ausgaben decken eine nachweislich unstillbare Nachfrage und sind somit nicht spekulativ. Für Anleger bedeutet das: Statt eine Blase zu fürchten, sollten sie die Entstehung dieser neuen Infrastruktur, finanzieren. Deren Aufbau ist nicht allein von den bekannten Tech-Giganten abhängig, sondern wird von einem breiten Ökosystem hochspezialisierter Tech-Nebenwerte gestützt.
Es handelt sich allerdings auch um einen Goldrausch mit hohen Vorabinvestitionen und Potenzial für Überkapazitäten. Historisch betrachtet hielt die Talsohle rund fünf Jahre (bei einem Kursrückgang von 50 % vom Hoch); die Rückkehr zum Vorkrisenniveau dauerte teils 10 bis 15 Jahre. Für Anleger ist daher Geduld gefragt.