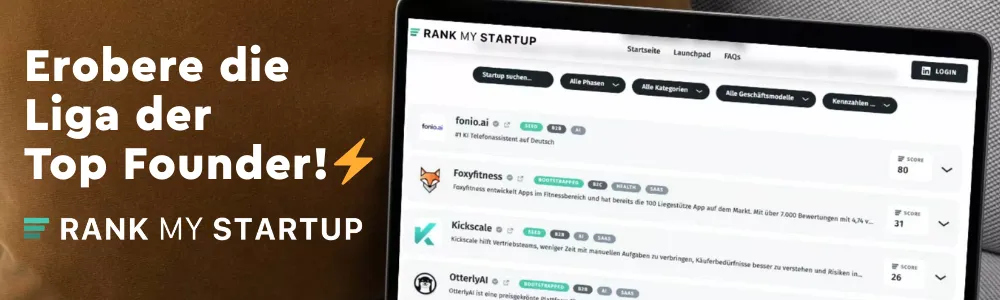Studie: Dachfonds soll Österreichs „Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit“ stärken

Der österreichische Dachfonds ist beschlossen und kommt immer näher. Dieses Investitionsinstrument soll dazu dienen, heimischen Startups Zugang zu mehr Risikokapital zu ermöglichen, besonders in der Wachstumsphase. Am Donnerstag haben Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus, Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria, und Philipp Kinsky, Partner bei Herbst Kinsky, eine neue Studie zum Dachfonds präsentiert. Dieser zufolge könnte ein Fonds mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 500 Millionen Euro bis zu eine Milliarde Euro zusätzliche Wertschöpfung sowie rund 1.500 neue Arbeitsplätze schaffen.
Österreich hinkt bei Risikokapital hinterher
„Wir wollen, dass Österreichs innovativste Unternehmen nicht ins Ausland abwandern müssen, nur weil hier die Finanzierungsrunden zu klein bleiben. Mit dem Startup-Dachfonds schaffen wir die Voraussetzung, privates Kapital zu mobilisieren und Wachstum im internationalen Maßstab zu ermöglichen. Damit halten wir Wertschöpfung, Jobs und Talente im Land und machen Österreich zu einem starken Startup-Standort im Herzen Europas“, sagte Elisabeth Zehetner bei der Präsentation.
Österreich hinkt bei der Verfügbarkeit von Risikokapital deutlich hinterher, was die Studie erneut bekräftigte. Die Analyse legte den Fokus auf strukturelle Hindernisse des heimischen Venture-Capital-Markts, zeigt internationale Best Practices auf und quantifiziert die volkswirtschaftlichen Effekte eines Dachfonds. Dabei zeigte sich wieder einmal, dass Österreich weiterhin bei der Frühphasenfinanzierung stark ist. Über 52 Prozent der Startups erhalten staatliche Zuschüsse. Doch beim Risikokapital lässt Österreich im internationalen Vergleich stark nach. 2024 betrug der Anteil von Venture-Capital-Investitionen nur 0,02 Prozent des BIP. Österreich verliert so Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Talente.
Dachfonds nach dem Vorbild von Deutschland und Dänemark
Die Bundesregierung hat daher einen übergeordneten „Standort-Fonds“ beschlossen. Die Studie sieht Deutschland und Dänemark als mögliche Vorbilder dafür, wie man es besser machen kann. In Deutschland gibt es den KfW Capital Wachstumsfonds und in Dänemark den Dansk Vækstkapital, die zeigen, dass ein öffentlich-privates Dachfondsmodell erfolgreiches privates Kapital mobilisieren kann. Hier tritt der Staat als Ankerinvestor auf, zieht institutionelle Anleger nach und stärkt so den heimischen Standort.
„Der Dachfonds braucht eine stabile rechtliche Grundlage, damit private Investoren Vertrauen fassen, Mit einer Struktur nach internationalem Vorbild und einem professionellen, unabhängigen Management wird sichergestellt, dass politische Einflussnahme ausgeschlossen bleibt und Kapital effizient eingesetzt werden kann. So entsteht ein verlässlicher Rahmen, um Wachstum zu finanzieren und Investitionen in Zukunftstechnologien zu ermöglichen“, so Philipp Kinsky.
Elisabeth Zehetner: „Mit fertigem Konzept für den Dachfonds rechne ich erst 2026″
Bis zu eine Milliarde Euro Wertschöpfung und 1.500 neue Jobs
In der Studie findet sich ein Vorschlag für den geplanten Fonds. Dieser soll eine unabhängige Organisation mit professionellem Management sein. Er soll frei von politischem Einfluss sein, um das Vertrauen privater Investoren zu sichern. Der Fonds soll nicht direkt in Startups investieren, sondern in VC- und Private-Equity-Fonds mit Sitz oder Zulassung in Europa. Rund 60 Prozent des Geldes sollen in Wachstumsfinanzierungen (ab Series A) fließen, 40 Prozent in Seed- und Frühphasen. Die unterstützten Fonds sollen sowohl thematisch offen als auch spezialisiert sein. Ein besonderer Fokus soll auf Technologien wie AI, GreenTech, Life Sciences und Industrie-Innovationen liegen.
Zwei mögliche Szenarien für den Dachfonds legt die Studie fest. In einem würde der staatliche Beitrag 100 Millionen Euro betragen und das Gesamtvolumen 500 Millionen Euro. Hier würden aus dem Fonds bis zu eine Milliarde Euro zusätzliche Wertschöpfung und etwa 1.500 neue Arbeitsplätze resultieren. Ein weiteres Szenario geht von einem staatlichen Beitrag von 60 Millionen Euro aus, während das Gesamtvolumen bei 300 Millionen Euro liegt. Hier läge die zusätzliche Wertschöpfung bei 600 Millionen Euro und es würden 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Positive Effekte hätte der Dachfonds auch auf Unternehmensgründungen, Löhne, Konsum und Staatseinnahmen.
„Unsere Modellrechnungen zeigen, dass ein Dachfonds nicht nur die Finanzierungslücke für Startups schließt, sondern auch erhebliche volkswirtschaftliche Impulse auslöst. Darüber hinaus stärkt ein solches Instrument die Unternehmensdynamik, fördert die Entstehung neuer Firmen in Schlüsseltechnologien und verbessert die internationale Sichtbarkeit als Standort für Risikokapital. Damit leistet der Dachfonds einen nachhaltigen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit“, erläuterte Monika Köppl-Turyna.