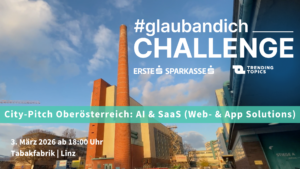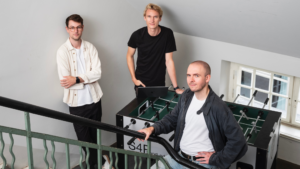CEE × DACH: Europas wichtigste Tech-Fusion findet jetzt statt

Am 12. Mai werden hunderte führende Tech-Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa – von Bukarest bis Budapest, von Sofia bis Riga – mit Investoren und CEOs aus der DACH-Region beim CEE Innovation Forum in Wien zusammenkommen.
Es ist ein Szenario, das vor einem Jahrzehnt noch selten vorkam, heute aber nahezu unvermeidlich erscheint. Die einst getrennten Startup-Ökosysteme der CEE- und DACH-Länder verschmelzen zunehmend zu einer einheitlichen Innovationslandschaft. Diese Fusion der Ökosysteme – lange angedeutet durch wirtschaftliche Logik und Talentströme – manifestiert sich nun anhand realer Deals, Expansionen und Partnerschaften im Herzen Europas.
Und während geopolitische Allianzen an Dynamik gewinnen, beginnt diese Konvergenz, die technologische Zukunft des Kontinents umzugestalten – wobei das bevorstehende CEE Innovation Forum in Wien als wichtiger Katalysator dient.
„Wir sehen unsere Rolle darin, langfristige Brücken zwischen den Innovationsökosystemen von CEE und DACH zu bauen“, sagt Teodor Antonio Georgiev, Mitgründer & Leiter des Storytelling Studio von The Recursive. „Nachdem wir im vergangenen Jahr auf Bits&Pretzels bedeutende Verbindungen geschaffen haben – wo unsere #BreakingGrounds-Delegation auf Investoren wie Creandum traf – setzen wir diesen Schwung fort. Das CEE Innovation Forum in Wien und unsere bisher größte Delegation bei GITEX Europe in Berlin sind darauf ausgelegt, diese Beziehungen zu vertiefen. Es geht nicht mehr nur um Sichtbarkeit – es geht um Dealmaking, gemeinsame Strategien und die Gestaltung einer europäischen technologischen Zukunft.“

Investitionsströme verbinden Ost und West
Risikokapital steht an vorderster Front der CEE–DACH-Konvergenz. In den letzten Jahren haben Investoren aus der DACH-Region zahlreiche CEE-Unternehmen unterstützt. Große Fonds aus Wien, Berlin und Zürich setzen auf Gründer:innen von Prag bis Sofia. Österreichische VCs wie Speedinvest, UNIQA Ventures, Elevator Ventures und Calm/Storm haben Dutzende von Investitionen in CEE in den Bereichen Fintech, Healthtech, Deep Tech und SaaS getätigt – wobei Speedinvest allein viele frühe Finanzierungsrunden anführte. Deutschlands Top-Fonds sind ebenso aktiv: Earlybird, Point Nine Capital, Creandum, Freigeist und andere haben gemeinsam eine Vielzahl von CEE-Unternehmen unterstützt.
Einer Schätzung zufolge haben Investoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mehr als 50 Startups aus der CEE-Region finanziert – darunter prominente Namen wie der bulgarische Drohnenhersteller Dronamics, das tschechische Fintech Twisto, das polnische Healthtech Docplanner, Rumäniens UiPath und das bulgarische Satelliten-Startup EnduroSat. Die Portfolios dieser DACH-Investoren gleichen einem „Who’s Who“ der CEE-Erfolgsstorys, was zeigt, wie eng die Regionen miteinander verflochten sind.
„Früher diente Wien als Drehkreuz für den Geschäftserfolg in CEE – warum sollte es nicht dasselbe für Startups tun? Bei Venturecake sind wir überzeugt, dass Europa mehr professionelle und vernetzte Strukturen benötigt, um die nächste Generation von Gründer:innen zu unterstützen. Unser gemeinsam betriebenes Accelerator-Programm ist unser Beitrag zu dieser Vision“, so Clemens Böhmer, Co-CEO von weXelerate und Gründungspartner von Venturecake.
Der Kapitalfluss wird durch Zahlen untermauert. Das Startup-Ökosystem in CEE ist längst nicht mehr die kleine Schwester Westeuropas – es zählt mittlerweile zu den am schnellsten wachsenden Technologiestandorten des Kontinents. Anfang 2025 erreichte der kombinierte Wert der CEE-Startups 243 Milliarden Euro, gegenüber 180 Milliarden Euro nur fünf Jahre zuvor.
Allein im Jahr 2024 sammelten Unternehmen in CEE 2,3 Milliarden Euro an Risikokapital, 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Tatsächlich hat CEE in den letzten fünf Jahren sogar Regionen wie Skandinavien und die DACH-Region selbst in puncto Investitionswachstum übertroffen. Mit 23 neuen Unicorns, die in den Jahren 2021 und 2022 aus CEE hervorgingen, betrachtet die globale Investorenlandschaft die Region als Europas nächste große Chance.
Bereits 2022 lancierte etwa der österreichische 3VC einen Fonds in Höhe von 150 Millionen Euro, um Startups in CEE und DACH gezielt zu unterstützen – ein bewusster Schritt, um beide Märkte zu verbinden. Ebenso weitete die rumänische Co-Investment-Plattform SeedBlink ihren Wirkungsbereich auf den DACH-Markt aus, um Geschäfte mit lokalen Business Angels und VC-Firmen zu syndizieren und verdoppelte ihr geplantes Investitionsvolumen für 2024, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.
Die Botschaft ist klar: Die Mauern zwischen den Risikokapitalmärkten im Osten und Westen Europas brechen ein, ersetzt durch einen einheitlichen Korridor des Kapitals.

Startups wachsen über die Grenzen hinaus
Für Gründer:innen in CEE ist die DACH-Region zum natürlichen Sprungbrett für internationales Wachstum geworden. Mit ihrer beträchtlichen Marktgröße, hohen Kaufkraft und geografischen Nähe ist DACH ein wesentlicher Wachstumsmarkt für viele CEE-Unternehmen, wie ein Bericht von The Recursive feststellt. So zählen beispielsweise das bulgarische Fintech-Unicorn Payhawk oder das tschechische Hospitality-Tech-Unicorn Mews zu den Firmen, die Deutschland und Österreich als zentrale Zielmärkte benannt haben.
Sektor für Sektor – von Unternehmenssoftware über Fintech bis hin zu Klimatechnologien – sehen CEE-Startups die DACH-Region nicht als fremdes Terrain, sondern als eine Erweiterung ihres heimischen Spielfelds. Das gilt auch umgekehrt: Zahlreiche deutsche und österreichische Accelerator-Programme werben aktiv Gründer:innen aus Polen, Rumänien oder den Balkanländern an, in dem Bewusstsein, dass einige der vielversprechendsten neuen Unternehmungen dort entstehen.
Geschichte und Wirtschaft erklären, warum diese „Fusion“ der Märkte so natürlich wirkt. CEE und DACH sind keine Fremden – sie teilen jahrzehntelange Handelsbeziehungen und verflochtene Lieferketten, viele Unternehmen operieren in beiden Regionen. Das Ergebnis ist eine historisch vernetzte Technologiebranche, die grenzüberschreitende Expansion nahezu intuitiv erscheinen lässt.
Auch die geografische Nähe spielt eine wichtige Rolle. Diese Nähe hat einen wachsenden, bilingualen und binationalen Talentpool sowie eine kulturelle Überschneidung in den Geschäftspraktiken gefördert. Kurz gesagt: DACH bietet CEE-Start-ups einen großen, zugänglichen Spielplatz direkt vor der Haustür – und CEE versorgt DACH mit innovativen, schnell wachsenden Ideen, die im gesättigten heimischen Markt schwer zu finden sind. Es ist eine Symbiose, die beide Seiten begrüßen.
Unternehmen und Talente suchen ein gemeinsames Ökosystem
Nicht nur Risikokapitalgeber und Gründer:innen treiben diese Konvergenz voran. Große Unternehmen in der DACH-Region blicken zunehmend gen Osten, um Innovation und Talent zu gewinnen. Ein anschauliches Beispiel fand 2021 statt, als der deutsche Logistikriese DHL mit dem bulgarischen Drohnen-Startup Dronamics zusammenarbeitete, um Fracht-Drohnen-Lieferungen am selben Tag zu erreichen.
Der Deal verdeutlichte, wie ein DACH-Unternehmen die Deep-Tech-Expertise aus CEE anzapfen kann, um an der Spitze der Innovation zu bleiben. Ähnliche Partnerschaften häufen sich: Automobilfirmen aus Bayern gründen F&E-Zentren in Ungarn und Rumänien; österreichische Banken integrieren Fintech-Lösungen aus ganz CEE. Diese Allianzen ergeben ökonomisch Sinn – CEE-Startups bieten häufig spezialisierte Innovation und agile Entwicklung, während DACH-Unternehmen mit Ressourcen und globalen Vertriebskanälen punkten. Das Ergebnis ist eine Win-Win-Situation aus Einfallsreichtum und Skalierung.
Dem steht eine drängende Talentdynamik zugrunde. Allein in Deutschland gab es 2024 etwa 149.000 unbesetzte IT-Stellen – ein rekordhoher Mangel an Technologie-Spezialist:innen. Diese Talentlücke kann kurzfristig nicht im Inland geschlossen werden und das wissen die Arbeitgeber in der DACH-Region. CEE hingegen bringt konstant hochqualifizierte Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen hervor, von denen viele entweder in den Westen abwandern oder remote für westeuropäische Unternehmen arbeiten. Anstatt dies als Brain Drain zu betrachten, nutzen fortschrittliche Firmen diese Dynamik durch verteilte Teams und grenzüberschreitendes Anwerben.
Das Resultat ist eine stärker durchmischte Arbeitswelt über beide Regionen hinweg, was effektiv einen einheitlichen Arbeitsmarkt im Tech-Bereich schafft. „Der Mangel an IT-Spezialist:innen in Deutschland ist ein systemisches Problem für die Wirtschaft“, warnte der Präsident des deutschen IT-Branchenverbands Bitkom – ein Problem, das durch eine engere Integration mit dem Talentpool aus CEE abgemildert werden kann. Ebenso erkennen CEE-Talente zunehmend Karrieremöglichkeiten nicht nur im Silicon Valley, sondern in den wirtschaftlich stärksten Zentren Europas, häufig durch Partnerschaften oder Übernahmen durch in der DACH-Region ansässige Unternehmen. Dieser Austausch von Talenten verstärkt die Verschmelzung der Ökosysteme auf menschlicher Ebene und verknüpft Netzwerke von Unternehmer:innen, Engineers und Führungskräften von Zürich bis Zagreb.
Auch strategische Überlegungen spielen eine Rolle. Die letzten Jahre geopolitischer Umwälzungen – von Lieferkettenkrisen bis zum Krieg an Europas östlicher Grenze – haben die Bedeutung einer belastbaren, paneuropäischen Innovationsbasis verdeutlicht.
Die Stärken von CEE in Bereichen wie Cybersicherheit, Verteidigungstechnologie und KI werden nun als wertvolle Ressource für ganz Europa erkannt. Bezeichnend ist, dass beim bevorstehenden CEE Innovation Forum in Wien unter anderem ein neuer Bericht „Who Is Protecting Europe’s Future?“ über den Stand von Verteidigung und Cybersicherheit in CEE vorgestellt wird.
DACH-Investoren und Unternehmensinnovatoren haben ein reges Interesse an solchen Sektoren, da die Grenzen zwischen nationaler Sicherheit und technologischer Innovation zunehmend verschwimmen. Durch die engere Zusammenarbeit mit CEE und dessen tiefgreifender Expertise in Cybersicherheit gewinnt Westeuropa an Sicherheit und strategischer Tiefe. Im Gegenzug erhalten CEE-Unternehmen Zugang zu größeren Verträgen und Partnerschaften, die ihnen bisher möglicherweise verwehrt blieben. Der Drang, gemeinsam zu handeln – eine Zukunft zu gestalten, in der Warschau und Sofia Hand in Hand mit München und Wien innovieren – war noch nie so ausgeprägt und vorteilhaft.
CEE Innovation Forum markiert den Wendepunkt
All diese Trends – Kapitalströme, Expansionen der Startups, Unternehmensallianzen und Talentaustausch – konvergieren nicht zufällig, sondern als Teil einer systemischen Evolution. Was einst ein opportunistischer Zufluss grenzüberschreitender Aktivitäten war, hat sich zu einem stetigen Strom und nun zu einer koordinierten Flut entwickelt. Das diesjährige CEE Innovation Forum in Wien symbolisiert diese neue Realität. Es fungiert als hochkarätiger Treffpunkt für Tech Leader aus CEE und Risikokapital- sowie Unternehmensvertreter:innen aus der DACH-Region, um die bereits in Gang gesetzte Zusammenarbeit weiter zu beschleunigen.
Zum ersten Mal ermöglicht eine dedizierte Plattform ein strukturiertes Matchmaking zwischen den Schlüsselakteuren beider Regionen – das hat Beobachter:innen in den vergangenen Jahren gefehlt.
Am 12. Mai werden im weXelerate-Hub in Wien über 500 Teilnehmende erwartet – darunter Startup-CEOs, Risikokapitalpartner:innen, Innovationsscouts aus Unternehmen sowie politische Entscheidungsträger:innen aus ganz Europa. In exklusiven, kuratierten Meetings und „Speed-Dating“-Sessions sollen Partnerschaften zwischen führenden DACH-Investoren/Unternehmen und vielversprechenden CEE-Startups angestoßen werden.
Parallel dazu werden Panels und Fallstudien analysieren, was es braucht, um in grenzüberschreitender Expansion erfolgreich zu sein – mit Lehren aus jenen, die bereits die Lücke überbrückt haben. Bemerkenswert ist, dass DACH-Venture-Firmen sowie Corporate-VC-Teams stark vertreten sein werden, was ihr ernsthaftes Engagement bei der Erschließung von CEE-Chancen unterstreicht.
Entscheidend ist, dass der Ton dieser Veranstaltung nicht aus werbendem Enthusiasmus besteht, sondern strategisch und pragmatisch ist. Ziel ist es, die „CEE × DACH“–Verbindung langfristig reibungslos zu gestalten. Als eines der Flagship-Events der ViennaUP 2025 steht das Forum unter dem Schirm der Stadt und positioniert Wien als Brücke zwischen Ost und West.
Die österreichische Hauptstadt, die historisch als Tor zu CEE diente, nutzt diese Rolle nun auch im Technologiekontext – sie ermutigt Gründer:innen, Wien als Sprungbrett zu wählen, und fordert westliche Investoren auf, verstärkt im Osten nach Möglichkeiten zu suchen. Damit wird deutlich: Die Verschmelzung der Ökosysteme ist kein einmaliges Schlagwort einer Konferenz, sondern ein nachhaltiger Wandel.
Ein neuer paneuropäischer Innovationsblock
Während CEE und DACH zu einem stärker integrierten Technologiestandort verschmelzen, sind die Implikationen tiefgreifend. Wir erleben im Grunde den Aufstieg eines neuen paneuropäischen Innovationsblocks, der sich von den Baltischen Staaten und dem Balkan bis zu den Alpen erstreckt. Dieses kombinierte CEE–DACH-Tech-Ökosystem vereint beeindruckende Stärken: einerseits hohe Wachstumsraten und kostengünstiges Talent im Osten, andererseits tiefe Kapitalreserven und ausgereifte Märkte im Westen.
Wirtschaftlich stellt es eine Fusion komplementärer Vorteile dar, wodurch die gesamte Region global wettbewerbsfähiger wird. Strategisch bedeutet dies, dass Innovationen innerhalb der europäischen Grenzen skaliert werden können – mit einem Markt von über 200 Millionen Menschen, bevor der Sprung in die USA oder nach Asien gewagt wird. Kulturell fördert die Fusion zudem den Anspruch, dass europäische Technologie nicht nur London, Paris oder Berlin bedeutet – dazu zählen auch Städte wie Cluj-Napoca, Bratislava und Wien, die Teil derselben Erfolgsgeschichte sind.
Nichts davon geschah über Nacht. Es ist das Ergebnis jahrelanger Grundlagenarbeit: frühe Investoren, die auf „Außenseiter“-Gründer:innen setzten, Unternehmen, die F&E-Zentren im Ausland eröffneten, und Gründer:innen, die sich unermüdlich über Sprach- und Grenzbarrieren hinweg vernetzten. Diese Anstrengungen erreichen nun eine kritische Masse.
Was sich 2025 ändern wird, ist das Maß an Zielstrebigkeit und Umfang. Die „Verschmelzung der Ökosysteme“ ist nicht mehr zufällig – sie ist geplant. Initiativen wie das CEE Innovation Forum veranschaulichen diesen bewussten Vorstoß zur Integration. Sie strukturieren die zahlreichen, sich organisch bildenden Verbindungen, sodass es den einzelnen Akteuren leichter fällt, zusammenzufinden. Nach und nach führen solche Interaktionen zu einem selbstverstärkenden Kreislauf: Erfolgsgeschichten wecken Interesse und senken das wahrgenommene Risiko grenzüberschreitender Unternehmungen, was wiederum zu einem noch größeren Fluss von Kapital und Ideen führt.
Für Investoren und Führungskräfte im Bereich der Unternehmensinnovation bietet die Konvergenz sowohl Chancen als auch einen Handlungsdruck. Wer die Feinheiten – den wirtschaftlichen Aufschwung, die strategische Widerstandsfähigkeit und das Talent-Arbitrage – erkennt, kann sich als First-Mover in einem Markt positionieren, der sich im Grunde verdoppelt. Es bedeutet Zugang zu einer breiteren Innovationspipeline und die Möglichkeit, sich über verschiedene Volkswirtschaften hinweg abzusichern. Die klügsten Akteure passen ihre Strategien bereits an diese Realität an und betrachten CEE und DACH als einen zusammenhängenden Markt.
Während Europas größte Ökosystemfusion an Fahrt gewinnt, zeichnet sich ein erfrischend positives Narrativ ab: Es geht um Integration und Wachstum, nicht um Konsolidierung durch Übernahmen oder Nullsummenspiele. Die CEE-DACH-Geschichte ist die Geschichte zweier dynamischer Gemeinschaften, die erkennen, dass sie gemeinsam stärker sind – ein Fall, in dem das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.
Im Kontext des Wiener Forums und darüber hinaus wird die Gesamtstimmung diesen gemeinsamen Zweck zweifellos widerspiegeln. Die ursprüngliche Kluft zwischen „aufstrebenden“ und „etablierten“ Märkten schließt sich rapide. Stattdessen entsteht ein gemeinsamer Innovationsmotor, der mit reichlich Talent und Kapital betankt wird. Wenn dieser Motor an Fahrt gewinnt, könnte er Europa auf ein neues Level technologischer Wettbewerbsfähigkeit auf der Weltbühne katapultieren. Die Botschaft an Unternehmen und Investoren auf beiden Seiten ist klar: Die Grenzen sind offen, die Ökosysteme verschmelzen, und jetzt ist die Zeit, gemeinsam die nächste Generation europäischer Erfolgsgeschichten zu gestalten.