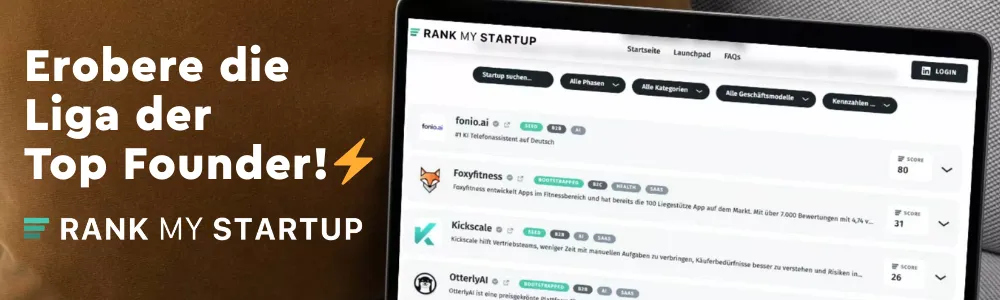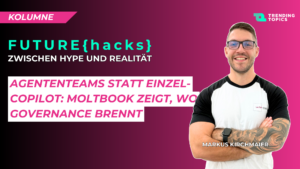Twilio: Die Schattenkosten von KI-Investitionen und wie Unternehmen sie bewältigen

Künstliche Intelligenz löst Milliarden-Investitionen und hohe Erwartungen aus. Laut Bitkom-Studie erwarten in Deutschland 73 Prozent der Unternehmen eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit durch KI, 64 Prozent rechnen mit sinkenden Kosten und 68 Prozent mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Gleichzeitig wächst die Skepsis, ob diese Erwartungen erfüllt werden können. Ein Twilio-Report zeigt, dass dennoch 97 Prozent der Firmen in den kommenden fünf Jahren mehr in KI investieren wollen, 77 Prozent bereits in den nächsten zwölf Monaten.
Zachary Hanif, Head of AI, ML and Data bei Twilio, identifiziert zwei Arten versteckter KI-Kosten: technische und operative. Technisch unterscheidet sich KI fundamental von klassischer Software. „Ein KI-Modell bildet den Zustand der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt ab. Es wird mit Daten trainiert, die im Lauf der Zeit an Relevanz verlieren“, erklärt Hanif.
Während klassische Software mit gelegentlichen Updates auskommt, erfordert KI kontinuierliche Pflege. Doch Operativ fehlt es vielen Unternehmen an klaren Zielen und messbaren Ergebnissen für ihre KI-Projekte sowie an definierter Governance und gemeinsamer Infrastruktur.
Kontinuierliche Wartung als Schlüsselfaktor
„KI ist keine Technologie, die man einmal einrichtet und dann vergisst“, betont Hanif. Jede KI-Investition benötige einen klaren Wartungs- und Kontrollplan mit festgelegten Intervallen für das Nachtrainieren, messbaren Kennzahlen zur Leistungsbewertung und definierten Schwellenwerten für Anpassungen. „Wer KI betreibt, häuft technische Schulden an. Diese entstehen durch den Aufwand, der nötig ist, um die Leistungsfähigkeit der Modelle zu erhalten.“ Ähnlich wie bei Fahrzeugen sollten laut Hanif KI-Modelle je nach Anwendungsbereich monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich überprüft werden.
Der Kauf oder die Lizenzierung macht bei KI-Investitionen nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten aus. Den Löwenanteil bilden Wartung, Schulung und Support. Da sich die Welt ständig verändert, muss die Qualität der Modelldaten regelmäßig überprüft werden. „Ohne regelmäßige Anpassung wächst dieser Aufwand an und kann zu Kontrollverlust führen“, warnt Hanif.
Lehren aus früheren Technologiewellen
Trotz ihrer Innovationskraft bleibt KI letztlich ein Werkzeug. Hanif empfiehlt, aus früheren Technologiewellen wie der Einführung des Internets oder dem Aufstieg der Cloud zu lernen: Den Hype ignorieren und realistisch testen, offen für Lernkurven bleiben, Ziele klar definieren und Nutzen messbar machen sowie flexibel und experimentierfreudig bleiben. „Verborgene Kosten dürfen den Nutzen von KI nicht überdecken“, resümiert er.
Für eine erfolgreiche KI-Strategie erweisen sich saubere Daten, gemeinsame Systeme, konsequente Modellpflege, kontinuierliche Überwachung, angemessene Sicherheitsmaßnahmen und klare Governance-Strukturen als entscheidend. Unternehmen, die diese Faktoren berücksichtigen, können die versteckten Kosten ihrer KI-Investitionen besser kontrollieren und den Weg zur produktiven Anwendung stabilisieren.