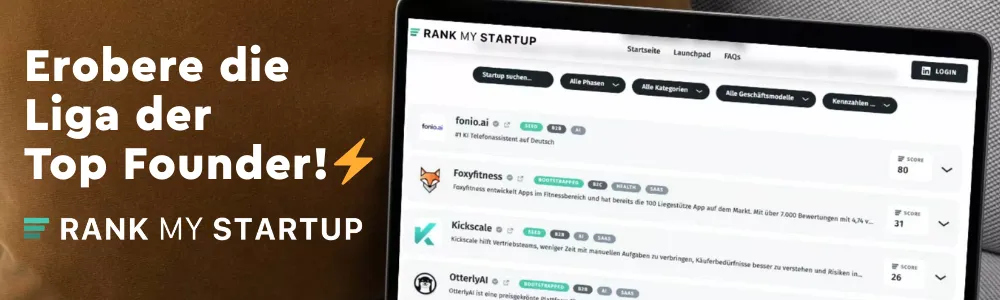Das europäische Paradox: Hohe Forschungsausgaben, ernüchternde Spin-off-Zahlen

Österreich investiert massiv in Forschung und Entwicklung und gehört bei den F&E-Ausgaben zur europäischen Spitze. Doch bei der Kommerzialisierung dieser wissenschaftlichen Exzellenz hinkt das Land hinterher. Ein neues Expert Paper von New Venture Scouting (NVS) rund um Gründer und CEO Werner Wutscher analysiert das österreichische Transfer-Ökosystem und zeigt sowohl vielversprechende Entwicklungen als auch strukturelle Herausforderungen auf.
Das europäische Paradox trifft Österreich
Das sogenannte „European Paradox“ beschreibt die Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und schwacher Kommerzialisierungsfähigkeit in Europa. Während die EU bei Forschungsleistung mit den USA konkurriert, liegen die Risikokapitalinvestitionen in den USA um das Vier- bis Fünffache höher. Über 60% aller globalen Unicorns haben ihren Sitz in den USA, nur 8% in der EU.
Österreich spiegelt diese Situation wider: Trotz Rang 2 bei öffentlichen F&E-Ausgaben in der EU ist das Land im EU-Innovationsranking von Platz 6 (2023) auf Platz 8 (2025) abgerutscht. Besonders deutlich wird die Lücke bei akademischen Spin-offs – Unternehmensgründungen aus Hochschulen heraus.
Ernüchternde Zahlen bei Spin-offs
Die Statistiken sind eindeutig: In Österreich entstehen laut Austrian Startup Monitor etwa 90 akademische Gründungen pro Jahr. Die enger gefassten Verwertungs-Spin-offs der öffentlichen Universitäten – Ausgründungen basierend auf universitärem geistigem Eigentum – beliefen sich 2024 auf nur 22 Unternehmen.
Im DACH-Vergleich ist die Position schwach: Keine österreichische Hochschule befindet sich unter den Top 10 bei Gründungszahlen, nur drei (TU Wien, WU Wien, Universität Wien) schaffen es in die Top 25. Führende europäische Universitäten wie Cambridge, ETH Zürich oder TU München generieren einzeln mehr Verwertungs-Spin-offs als alle österreichischen Universitäten zusammen.
Chancen: Politischer Rückenwind und neue Strukturen
Die positive Nachricht: Das Thema hat höchste politische Priorität erhalten. Die FTI-Strategie 2030 strebt eine Verdoppelung erfolgreicher Spin-offs an. Die Leistungsvereinbarungen 2025-2027 sehen 89 neue Verwertungs-Spin-offs vor.
Gezielte Förderinstrumente entstehen:
-
Die aws Spin-off-Initiative fördert Beteiligungsgesellschaften und universitätsnahe VC-Fonds
-
Erfolgreiche Beispiele wie das MedLifeLab der Medizinischen Universität Innsbruck, WU Ignite Ventures oder Noctua Science Ventures (TU Wien/Speedinvest) zeigen schnelle Umsetzungsmöglichkeiten
-
Der entwickelte „Ausgründungsrahmen“ standardisiert Prozesse und Strukturen
Volkswirtschaftlicher Impact: Studien belegen, dass jeder Euro gezielter Spin-off-Förderung zu sieben Euro BIP-Zuwachs führt. Erfolgreiche Ausgründungen schaffen qualifizierte Arbeitsplätze, stärken die Hochschulreputation und ziehen Talente an.
Risiken: Strukturelle Nachteile und Finanzierungslücken
Historischer Rückstand: Österreich begann erst vor 10-15 Jahren mit systematischer Transferförderung, während USA, UK oder Schweiz jahrzehntelang etablierte Ökosysteme aufgebaut haben. Um aufzuholen, reicht Nachahmung nicht – die Entwicklung muss beschleunigt werden.
Finanzierungsschwäche: Österreich liegt bei Venture-Capital-Investitionen relativ zum BIP unter dem EU-Durchschnitt (Rang 16). Gerade Spin-offs mit hochkomplexen Technologien benötigen jedoch substantial Kapital für die Kommerzialisierung.
Mangelnde kritische Masse: Als kleiner Standort fehlt oft die Sichtbarkeit für internationale Investoren und Unternehmenspartner. Einzelne Hochschulen können schwer mit internationalen Leuchttürmen konkurrieren.
Lösungsansätze: Kooperation und Professionalisierung
Das NVS-Paper identifiziert drei Schlüsselelemente für erfolgreiche Spin-off-Ökosysteme:
Regionale Kooperation: Bündelung von Gründungsaktivitäten mehrerer Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach dem Vorbild der deutschen EXIST Startup Factories. Nur durch kritische Masse wird ein Standort für Investoren interessant.
Professionelle Hochschulstrukturen: Drei ineinandergreifende Elemente sind notwendig:
-
Gezieltes Scouting und Incentivierung von Gründungsvorhaben
-
Professionelle Begleitung durch kommerziell erfahrene Teams
-
Zugang zu Risikokapital durch Hochschul-Netzwerke oder eigene Fonds
Best-Practice-Transfer: Österreich kann von etablierten internationalen Ökosystemen lernen, ohne bei null beginnen zu müssen.
Fazit: Aufbruchsstimmung mit Realitätscheck
Österreich steht vor einem Wendepunkt im Transfer-Ökosystem. Die politische Unterstützung ist da, erste strukturelle Reformen greifen, und erfolgreiche Pilotprojekte zeigen den Weg. Gleichzeitig darf der internationale Konkurrenzdruck nicht unterschätzt werden, so der Schluss seitens NVS.