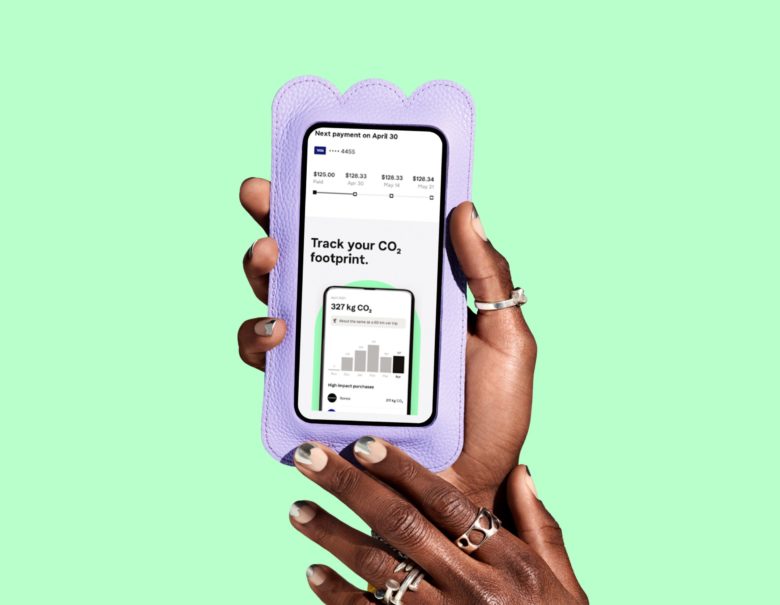Ökonom: „Nachhaltigkeit wird in Österreich stiefmütterlich behandelt“

„Es ist etwas Besonderes, dass sich eine Fachhochschule ein eigenes Forschungsinstitut leistet“, sagt Markus Scholz, der die Leitung des neuen Institute for Business Ethics and Sustainable Strategy (IBES) an der FH Wien übernommen hat. Warum das IBES dann gegründet wurde? Weil sich im Bereich Nachhaltigkeit gerade so viel tut, dass es schwierig ist, am neuesten Stand zu sein. Und das will die FH Wien auf jeden Fall sein, denn Nachhaltigkeitsmanagement und Unternehmensethik sind Pflichtfächer in jedem Masterstudiengang.
„Unternehmen beginnen gerade erst zu verstehen, wie wichtig und umfangreich dieses Thema ist“, so Scholz, der für das IBES renommierte Forschungspartner wie die Universität St. Gallen, die Harvard University, die TU München oder die INSEAD Business School gewonnen hat. Im Interview mit Tech & Nature spricht der Ökonom darüber, wie Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit treiben können und in welchem Ausmaß das in Österreich bereits geschieht.
Tech & Nature: Kommt Nachhaltigkeit aus der Nische und tritt bei Innovationsstrategien an die Seite der Digitalisierung?
Markus Scholz: Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die Mega-Themen der nächsten 20 Jahre.
Spiegelt sich das in Unternehmen bereits wieder? Man hört oft das Vorurteil, dass Nachhaltigkeitsmanagement ein wenig stiefmütterlich betrachtet wird.
Ja, diese Positionen sind in Unternehmen häufig noch eher Feigenblatt-Positionen. CSR-Manager oder Nachhaltigkeitsmanager hat man halt, manchmal sitzen die aber in der Kommunikation oder im Controlling. Es ist die Frage, wieviel Einfluss man da nehmen kann. Das ändert sich aber tatsächlich. Es gibt bereits einige Unternehmen, die diese Position im Vorstand oder direkt darunter ansiedeln.
Wie sind österreichische Unternehmen im internationalen Vergleich in diesem Bereich aufgestellt?
Es gibt in Österreich einige tolle Vorreiter, die überwiegende Zahl hat das Thema aber noch nicht richtig auf der Agenda.
Warum ist das so?
Im Vergleich zu Deutschland wird das Thema Nachhaltigkeit in Österreich grundsätzlich stiefmütterlich behandelt – auch in der aktuellen Regierung. Es gibt keinen großen politischen Druck, sich diesem Thema zu nähern. Ich habe in Österreich in den acht Jahren, in denen ich das jetzt beobachte, noch keine Regierung gesehen, die entsprechend Druck gemacht hat. Österreich hat auch keinen nationalen CSR-Plan – das ist wirklich schade.
Außerdem gibt es in Österreich keine großen Player wie Stiftungen, die das Thema wirklich für sich entdeckt haben. In Deutschland wäre das beispielsweise die Bertelsmann Stiftung. Anders als in Deutschland und in der Schweiz ist der Druck von Investorenseite in Österreich auch weniger zu spüren. Es sind große, börsennotierte Unternehmen, die das Thema gerade antreiben. Das tun sie aus zwei Gründen: Einmal, weil die EU gesagt hat, sie müssen. Zweitens, weil sie diese Pflicht an an Zulieferer weiterreichen. Die Unternehmen üben also Druck auf ihre Zulieferer aus. In Österreich funktioniert das einfach aufgrund des Wirtschaftsgefüges anders. Der Bereich Nachhaltige Investments wächst gewaltig und dort gibt es auch von sehr großen Investoren wie Blackrock Druck – aber auch das schlägt sich auf österreichische Unternehmen weit weniger durch als in Ländern mit anderer Wirtschaftsstruktur.
Wo liegt die Grenze zwischen Nachhaltigkeits-Management und Greenwashing?
Greenwashing ist es dann, wenn ein Unternehmen versucht, durch plakative Einzel-Maßnahmen davon abzulenken, dass es ein Nachhaltigkeitsproblem hat. Das grundsätzliche Problem ist meist, dass das Geschäftsmodell per se nicht nachhaltig ist. Man kann einzelne Aktionen setzen, wie den Verkauf von Produkten aus recyceltem Plastik, und sich damit einen Nachhaltigkeits-Anstrich geben. Das ändert aber nichts daran, dass das Kerngeschäft an sich problematisch ist.
Besteht nicht die Gefahr, dass Unternehmen diese vielen kleinen Schritte bleiben lassen, wenn sie immer wieder Greenwashing-Vorwürfen ausgesetzt sind?
Kleine Schritte sind ja trotzdem Schritte in eine gute Richtung. Was man aber nicht vergessen darf, ist, das Geschäftsmodell an sich zu hinterfragen. Nehmen wir die Automobilindustrie. Natürlich hat sie es in den letzten 20 Jahren geschafft, viel sicherere Autos zu bauen, die Motoren verbrauchen auch weniger, laufen länger und sauberer. Das ändert aber nichts daran, dass diese Industrie noch immer keinen Wechsel des Geschäftsmodells bzw. der Kerntechnologie geschafft hat. Es ist immer noch dreckige Technologie und immer noch ein Geschäftsmodell, das darauf baut, dass möglichst viele Menschen möglichst viele Autos kaufen. Kleine Nachhaltigkeitsprojekte geben Konsumenten und Managern im Unternehmen das Gefühl, dennoch genug zu tun. Es ist aber nicht genug, wenn man sich ansieht, was man in Hinblick auf die Klimakrise wirklich bräuchte.
Und natürlich ist es eine paradoxe Situation: Auf der einen Seite müssen diese Unternehmen weiter Geld verdienen, auf der anderen Seite müssten sie damit aufhören. Das kennen wir aber auch aus anderen Branchen, wenn es um Innovation geht. Kodak hat es zum Beispiel nicht geschafft, obwohl sie technologisch die besten Vorraussetzungen für die Digitalisierung der Fotografie hatten. Sie haben ihre bestehende, analoge Technologie weiterentwickelt und sind dann von anderen überrollt worden.
Haben Unternehmen mit einem nicht nachhaltigen Geschäftsmodell überhaupt eine Chance oder wird es denen so gehen wie Kodak?
Es gibt sehr wohl Möglichkeiten, mit disruptiver Innovation umzugehen. Die Antwort darauf sind Einheiten, die außerhalb des eigentlichen Geschäftes funktionieren. Mc Donald’s hat im Store In-Store-Lösungen gebildet – zum Beispiel Mc Cafe. Das sieht anders aus, es sind hochwertigere Produkte und es sieht auch so aus, als wären es nachhaltigere Produkte. Die sind frei von dem, was wir unter Mc Donald’s bisher verstehen: schnell und billig. Diese Idee, innerhalb des Unternehmens etwas Neues aufzubauen, quasi ein Startup im Unternehmen, hilft auf dem Weg, auf ein neues Geschäftsmodell umzustellen. Das passiert auch in der Automobilindustrie. VW hat das Unternehmen Moia gegründet, das frei von dem ist, was wir mit VW assoziieren. Moia verkauft keine Autos, es ist eine Carsharing-Plattform und eine Plattform, in der VW experimentieren kann. Mit solchen Einheiten kann man Innovationsprozesse hinbekommen.
Durch die Coronakrise wird das Thema Regionalisierung als Gegenkonzept zur Globalisierung stark gespielt. Wie beurteilen Sie das als Nachhaltigkeits-Ökonom?
Da steht man schon ein wenig zwischen den Fronten. Globalisierung ist ja erst einmal nichts Böses. Die Idee der Ökonomisierung oder Industrialisierung von Ländern, die bisher noch nicht so weit waren, hat in diesen Ländern Stabilität und häufig Wohlstand gebracht. Jetzt wäre es ja absurd, sich auf nationale Gebilde oder Teile der Union zurückzuziehen. Mit der Globalisierung sind aber auch extrem negative Effekte verbunden gewesen, weil einige Unternehmen ihre Wertschöpfungskette outgesourced haben und zwar in Länder, die geringere Umwelt- und Sicherheitsstandards haben.
Dieser aktuelle Rückzug auf das Regionale oder das Europäische ist meiner Meinung nach auf der einen Seite notwendig, aber auch gefährlich. In der Welt, wie sie heute formiert ist, sind diese sehr gespreizten Wertschöpfungsketten problematisch. Zum Beispiel beim Thema Pharma und die Versorgungssicherheit bei Medikamenten. Wenn wir unsere Grenzen schließen, die Zutaten für bestimmte Medikament aber außerhalb produziert werden, ist das natürlich schwierig. Eine Rückführung systemrelevanter Industrien näher an die Heimatmärkte scheint in der gegenwärtigen Lage strategisch richtig zu sein.
Wie sehen sie das bei der Lebensmittelproduktion, bei der dieses Thema gerade auch intensiv diskutiert wird?
Ähnlich. Es gab bisher bei Konsumenten die Idee, dass jedes Gemüse und jedes Obst 365 Tage im Jahr verfügbar ist. Das hat erhebliche negative Konsequenzen, wenn ein Apfel aus Peru importiert wird. Da gibt es zwei Seiten: Was wollen Konsumenten und was sind Unternehmen bereit, anzubieten? Bei Regionalität imLebensmittelbereich sehe ich erst einmal keine Nachteile in Hinblick auf Nachhaltigkeit. Außer vielleicht, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Produkte teurer werden.
Gerade bei Lebensmitteln ist die Entscheidung bei Konsumenten oft eine sehr schwierige. Sind Tomaten aus Spanien nachhaltiger als im Winter im Folientunnel in Österreich produzierte?
Saisonalität ist auch ein wichtiges Thema, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Aber natürlich, das gesamte Thema auf Konsumenten abzuwälzen, wie es Unternehmen gerne tun, geht auch nicht. Zu sagen: Wenn ihr keine Billig-T-Shirts haben wollt, die unter schwierigsten Arbeitsbedingungen produziert werden, dann kauft die halt nicht. Was Unternehmen mitunter vergessen: Es ist sehr schwer, sich als Konsument zu informieren, was in so einem Produkt steckt und wie es hergestellt wird. Und Unternehmen gehen von Konsumenten aus, die immer rationale Entscheidungen treffen. Wir wissen aber aus der Forschung, dass das noch viel weniger der Fall ist, als gemeinhin angenommen wird. Deshalb kann man die Verantwortung für Nachhaltigekit nicht nur auf Konsumenten abwälzen.
Brauchen wir in diesem Bereich auch einen stärkeren Staat und eine strengere Regulierung?
Ohne Unternehmen wird Nachhaltigkeit nicht funktionieren. Das sind die Akteure, die unsere Waren produzieren, vertreiben und mitunter auch zurücknehmen müssen. Aber wir brauchen auch den Staat und meiner Meinung nach schärfere Gesetze. Diese Gesetze müssten aber idealerweise globale Geltung haben, mindestens aber europäische. Wir sind aber global immer schwächer aufgestellt – die UN wird immer schwächer, die WHO ist in der Coronakrise immer wieder unterminiert worden. Global funktioniert relativ wenig.
Es gibt aber die interessante Idee der Private Governance, wo Unternehmen im Wesentlichen verstehen, dass es Probleme gibt und dass diese Probleme auch ihre eigenen Geschäftsmodelle betreffen. Dann fangen sie an, selbst zu regulieren. Das passiert zum Beispiel im Fischbereich, wo große Unternehmen zusammengeschlossen Fangquoten regulieren. Grundsätzlich löst das nicht alle Probleme, funktioniert aber besser als vieles andere.